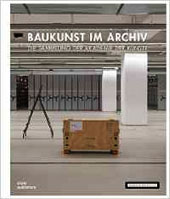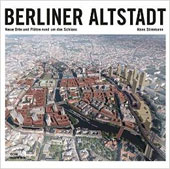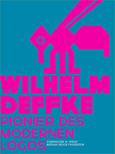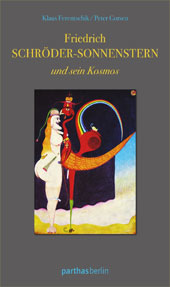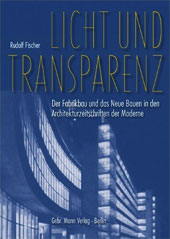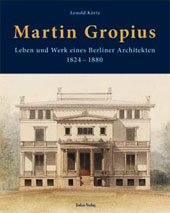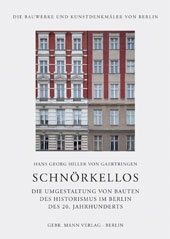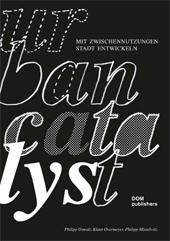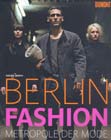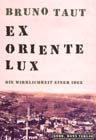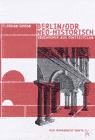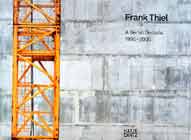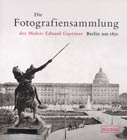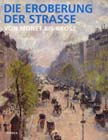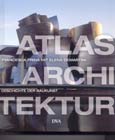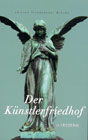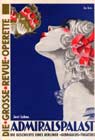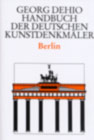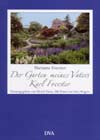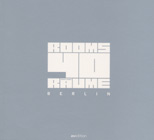|
|
|
|
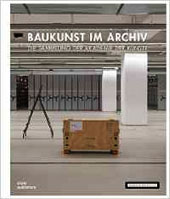 |
|
Eva-Maria Barkhofen (Hg.)
Baukunst im Archiv
Die Sammlung der Akademie der Künste
Dom publishers / Akademie der Künste, 2016
bei

Das Baukunstarchiv ist eine
Schatzkammer der Bauentwürfe und Baugedanken, zumal derer, die
unrealisiert geblieben und nur auf Papier vorhanden sind. Von
Richard Ermisch, etwa, stammt aus dem Jahr 1923 das Schaubild einer
Kirche der Weltreligionen, eine Idee, die heute wieder aufgenommen
und in Berlin Mitte als House
of One verwirklicht werden soll. Unter die besonderen Fundstücke
zählen auch die Aquarelle und Gouachen des 1940 von den Nazis
ermordeten Architekten und Malers Paul Goesch, Adolf Behnes
weitgestreute Korrespondenz mit den Größen der Architektur- und
Kunstwelt oder Bruno Tauts Zeichnung von 1920 für die Publikation
Auflösung der Städte mit dem Schriftzug „Lasst sie
zusammenfallen die gebauten Gemeinheiten! Steinhäuser machen
Steinherzen“
Ganze
Rezension |
|
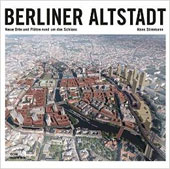 |
|
Hans Stimmann, u.a.
Berliner Altstadt
Neue Orte und Plätze rund um das Schloss
DOM publishers

Mag Hans Stimmanns Bild von einer
Bürgerstadt auf dem Gebiet von Alt-Berlin, Cölln und dem
Friedrichswerder auch stark historisch-romantische Züge tragen, so
werden ihm die Menschen, die sich an die zugige Atmosphäre des
Ostberliner Zentrums erinnern, doch darin recht geben, dass der
Rückbau von überdimensionierten Freiflächen und Asphaltschneisen
überfällig ist. Dieser Prozess der Verdichtung oder
Reurbanisierung wäre nur dann fatal, wenn angesichts der
gebauten Herrschaftsgeste der DDR in Berlins Mitte nur eine
neue ideologisch-gegenteilig motivierte Stadtgestaltung
herauskäme. Der jetzt entstehende Betonkörper des Humboldt-Forums,
bzw. des Schlosses, rechtfertigt jedenfalls gegenüber seinem
Vorgänger, dem Palast der Republik, noch keine Euphorie.
Vielleicht thematisiert deshalb die neue zweite Auflage der
Berliner Altstadt in ihrem Untertitel auch nicht das Schloss
selbst, sondern Neue Orte und Plätze rund um das Schloss.
Das sind der Schlossplatz, der Lustgarten, die Schlossfreiheit,
der neue Platz an der Spree, sowie die drei öffentlichen Räume
innerhalb des Humboldt-Forums.
Mehr
... |
|
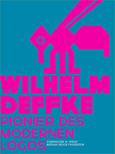 |
|
Bröhan Design Foundation
Wilhelm Deffke. Pionier des modernen Logos
Scheidegger & Spiess, 2014

Einunddreißig Signetentwürfe
für die Berliner Gallus Druckerei KG, allesamt Hähne, füllen eine
ganze Seite des Bandes und veranschaulichen die Arbeitsweise des
Künstlers. Von großer Bildhaftigkeit mit Schnabel, Kamm und
Schwanz, mit Krallen und Sporn bewegen sich die Vorschläge zu
einem suggestiven, immer abstrakteren Gestus. Wilhelm Deffke
(1887-1950), der Meister und große Pionier der Handelsmarken und
Fabrikzeichen, der Signets und Logos, nennt als Voraussetzungen
für ihre Wirksamkeit „größte Knappheit der Form, kraftvolle
Schönheit und eigenartige Erfindung“. Aber ist ein künstlerisch
wirkungsvolles Signet auch verkaufsfördernd? Bei seiner Tätigkeit
für die Druckerei und Verlagsanstalt Otto Elsner AG in der
Kreuzberger Oranienstraße – das Elsnerhaus unweit des
Moritzplatzes steht heute noch – traf Deffke auf seinen späteren
Geschäftspartner Carl Ernst Hinkefuß. Nachdem sie mitten im Ersten
Weltkrieg eine der ersten modernen Werbeagenturen Deutschlands,
das Wilhelmwerk, gegründet hatten, zerbrach ihre Zusammenarbeit an
eben dieser Frage nach der Vereinbarkeit von Kunst und
Nützlichkeit.
Mehr
... |
|
 |
|
Florian Hertweck und Sébastien Marot (Hg.)
Die Stadt in der Stadt. Berlin: ein
grünes Archipel
Ein Manifest (1977) von Oswald Mathias Ungers und Rem Koolhaas
mit Peter Riemann, Hans Kollhoff und Arthur Ovaska

Die südliche Friedrichstadt,
der Görlitzer Bahnhof, die Steglitzer Schloss-Straße,
Siemensstadt, Spandau, die sogenannte City um Tauentzien und
Kurfürstendamm, das Märkische Viertel, die Gropiusstadt, das
Tempelhofer Feld, die Hufeisen-Siedlung, die Onkel-Tom-Siedlung,
die Kulturinsel um Nationalgalerie, Philharmonie und
Staatsbibliothek, bilden als urbane Inseln, eingebettet in den
umgebenden grünen Landschaftsozean, ein Archipel – das war das
städtebauliche Bild, das Oswald Mathias Ungers und Rem Koolhaas in
den 70er Jahren für Berlin entworfen hatten. Die Stadt galt ihnen
als Labor eines alternativen städtebaulichen Modells, das im
Bevölkerungsschwund, wie er in zahlreichen Großstädten und
Metropolen vor sich ging und geht, kein Problem sondern eine
Chance sieht. Dem Modell der Entstädterung oder urbanen
Rückentwicklung sollten exemplarische Stadtgebiete mit einer
geschlossenen Struktur als zu entwickelnde Inseln oder Städte in
der Stadt dienen; die Gestaltung der Havellandschaft durch
Schinkel und Lenné mit Architekturen aus unterschiedlichsten
Stilrichtungen stand Pate für diese Idee.
Mehr
... |
|
|
|
|
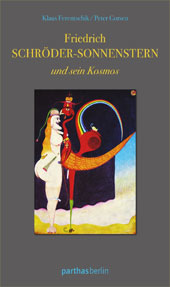 |
|
Klaus Ferentschik und Peter Gorsen
Friedrich
Schröder-Sonnenstern
und sein Kosmos

Früh beginnen die
Auseinandersetzungen Friedrich Schröders (1892-1982) mit den
gesellschaftlichen Zwangsinstitutionen. Ein Lehrer schildert ihn
„als in hohem Maße sittlich verkommenen, trotzigen,
hinterlistigen, tückischen und leugnerischen Jungen …“. Der Schule
folgen in turbulentem Wechsel Fürsorge, Besserungs- und
Irrenanstalten, Arreste und Gefängnisse. Sein früh entwickeltes
Widerstandswerkzeug sind Schalk, Scharlatanerie und Zotigkeit. Zu
Beginn der 50er Jahre, ausgerüstet mit dem Namen
Schröder-Sonnenstern, schafft er das Gros seines künstlerischen
Werkes, das namhafte internationale Freunde und Bewunderer findet,
darunter, den ihm in Eifer und Attitüde verwandten, Friedensreich
Hundertwasser, die Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt und Henry
Miller oder den Psychoanalytiker Erik Erikson.
Mehr
... |
|
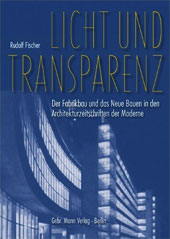 |
|
Rudolf Fischer
Licht und Transparenz.
Der Fabrikbau und das Neue Bauen
in den Architekturzeitschriften der Moderne

Der Industriebau, im späten 19.
Jahrhundert mit dunklen Höfen, engen Gängen, blinden Scheiben
und niedrigen dunklen Räumen eher einem Gefängnis als einer
Arbeitsstätte ähnlich, sei eine fast populäre Angelegenheit, dem
das Publikum mehr Aufmerksamkeit schenke als dem Kirchenbau oder
der Theaterarchitektur, schrieb der Architekturkritiker Adolf
Behne 1913. Er hatte dabei Bauwerke im Sinn, wie die Turbinenhalle
der AEG von Peter Behrens in Berlin-Moabit, Hans Poelzigs
Chemische Fabrik Moritz Milch & Co. in Luban bei Posen oder Walter
Gropius’ und Adolf Meyers Fagus-Werke in Alfeld, die alle vor dem
Ersten Weltkrieg entstanden sind. Dem vorangegangen war die Kritik
an überkommenen historisierenden Stilformen, wie sie vor allem von
Hermann Muthesius und dem 1907 von ihm gegründeten Deutschen
Werkbund vorgebracht wurde. Die Vereinigung von Künstlern,
Architekten und Unternehmern, die einem sachlichen Waren- und
Industriedesign zum Durchbruch verhelfen wollten, stand am Anfang
einer Entwicklung, die in einen Ingenieurskult und Technikchic
mündete.
Mehr
... |
|
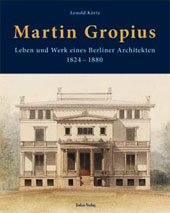 |
|
Arnold Körte
Martin Gropius
Leben und Werk eines Berliner Architekten. 1824-1880

Martin Gropius, der Karl
Friedrich Schinkel noch persönlich gekannt hatte, gehörte wie sein
Partner Heino Schmieden zur Enkelgeneration des großen preußischen
Baumeisters und zu den Bewahrern der Schinkelschule. Mit ihrem
weitgehenden Verzicht auf prunkvolles Äußeres galten Gropius &
Schmieden gegen den Zeitgeschmack als echte Vorläufer der Moderne.
Die mit reichem Fotomaterial ausgestattete, knapp 600-seitige
Monographie ist nach Werkgruppen – Wohnhäusern, Krankenhäusern,
Universitäts- und Bibliotheksbauten, Herrenhäusern und Schlössern,
Bank-, Handels- und Geschäftshäusern, Inneneinrichtungen,
Kunstgewerbe und Skizzenbüchern – geordnet. Vielleicht wegen der
intimen Kenntnis und des Zugangs zu privaten Nachlässen und
Briefen des verwandtschaftlich mit der Familie des Architekten
verbundenen Autors liest und betrachtet sich der Band wie ein
höchst lebendiges stadtgeschichtliches Porträt.
Mehr
. |
|
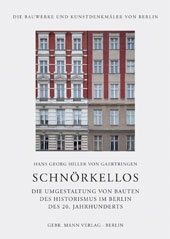 |
|
Hans Georg Hiller von Gaertingen
Schnörkellos.
Die Umgestaltung von Bauten
des Historismus im Berlin des 20. Jahrhunderts

Was dem unvoreingenommenen Geist wie das Gegenteil
von Architektur erscheint, die Entdekorierung der Bauten aus der
Zeit des Historismus, setzt in den 1920er Jahren ein und hält ein
gutes halbes Jahrhundert an. Das gesamte zwischen 1850 und 1914
entstandene Bauerbe galt als dekorativ überladen und verkitscht,
sein Stuck an Fassaden und Decken musste abgeschlagen, die
gemalten Dekore überstrichen, die Treppen, Geländer und Türen
ausgetauscht werden. Noch nach 1945 bis etwa 1970 verloren mehr
als die Hälfte der im Krieg nicht zerstörten Gründerzeitbauten ihr
Fassadendekor. Erst nach den 70er Jahren und verstärkt seit der
Wiedervereinigung setzte ein Umdenken ein, werden Stuckfassaden
erhalten und Gründerzeithäuser als städtischer Schmuck
wahrgenommen.
Mehr ... |
|
|
|
|
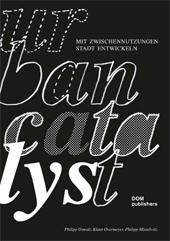 |
|
Philipp
Oswalt, Klaus Overmeyer, Philipp Misselwitz.
Urban Catalyst.
Mit Zwischennutzungen Stadt entwickeln

Die Kreativität des Augenblicks nutzen, sich von der Leere
inspirieren lassen, den Strömen des Lebens folgen, wären andere
mögliche Überschriften dieses ungemein interessanten, inhaltlich
wie formal gelungenen Manuals über den Umgang mit
desintegrierten oder weitgehend undefinierten Gebäuden und
öffentlichen Flächen. Nicht Architekten oder Planungsbehörden
haben in diesen Fällen die Definitionsmacht und bestimmen die
Nutzung, sondern, wie am Beispiel des Arizona Marktes in Belgrad
erläutert, übernehmen etwa Frauen die Initiative, die an einem
Verkehrsknotenpunkt mit dem Verkauf von Gemüse und
Selbstgestricktem aus der Hand den ersten Schritt tun. Die
Errichtung von Kiosken, Ladenzeilen bis hin zu kleinen
Einkaufszentren folgt dieser selbst organisierten, spontanen
Aktivität der Frauen.
Können diese Entwicklungen ermöglicht oder auch durchgesetzt
werden, bringen sie eine Frische und Kreativität in die
Stadtentwicklungsdiskussion, von der selbst Verwaltungsbeamte
fasziniert sind.
Mehr ... |
|
|
 |
|
Hans
Stimmann, u.a.
Zukunft des Kulturforums.
Abgesang auf die Insel der Objekte

Der geplante Umzug der Gemäldegalerie auf die Museumsinsel kommt
einem Weckruf an Politik und Bauwelt gleich, sich eines
Architekturphänomens zu erinnern, an dem nicht nur die
Wiedervereinigung vorbeigegangen ist, sondern das Zeit seines
Bestehens in seltener innerer und äußerer Unverbundenheit den
Stadtraum zwischen Landwehrkanal, Potsdamer Platz und Tiergarten
besetzt. Philharmonie, Neue Nationalgalerie und Staatsbibliothek
bilden seit den 60er Jahren zusammen mit weiteren Museen und der
nach dem Krieg wiederhergestellten Matthäuskirche eine Ansammlung
von zum Teil hochkarätigen Architekturen, die, von dem gewaltigen
Verkehrsband der Potsdamer Straße zerschnitten, wie willkürlich
hingeworfen erscheinen. Nationalsozialistische Baupolitik, der
Zweite Weltkrieg und nicht zuletzt die Abrisse und Zerstörungen
nach dem Krieg hatten das großbürgerliche Tiergartenviertel
zerstört und den Platz für das Kulturforum geebnet.
Mehr ...
|
|
|
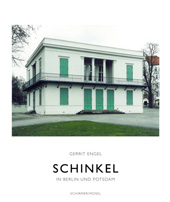 |
|
Gerrit Engel
Schinkel in Berlin und Potsdam
(Deutsch/Englisch)

Die zwischen 1816
und 1818 entstandene Neue Wache Unter den Linden markierte den
Auftakt der öffentlichen Bautätigkeit Karl Friedrich Schinkels
(1781-1841). Der zu der Zeit Dreißigjährige hatte sein Geld zuvor
mit innenarchitektonischen Gestaltungen und Ausmalungen verdient.
Neben dem Alten Museum am Lustgarten darf das heute als
Konzerthaus dienende Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt als
Hauptwerk gelten, mit dem der Baumeister gleich zweifach Ehre
einlegen konnte. Für die Eröffnungsaufführung von Goethes
Iphigenie, hatte Schinkel das Bühnenbild als einen Blick auf den
Gendarmenmarkt geschaffen, mit dem von den beiden Domen gerahmten,
von ihm neu errichteten Schauspielhaus, was das Publikum zu
Begeisterungsstürmen hingerissen haben soll.
Mehr ...
|
|
|
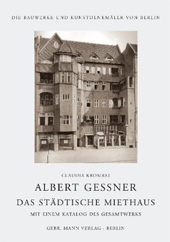 |
|
Claudia Kromrei
Albert
Gessner: Das städtische Miethaus.
Mit einem Katalog des Gesamtwerks

Albert Gessner (1868-1953) war in der Zeit zwischen 1900 und dem
Ersten Weltkrieg einer der bekanntesten und wirtschaftlich
erfolgreichsten Architekten Berlins. Er wurde in einem Atemzug mit
Männern wie Alfred Messel, Paul Mebes oder Hermann Muthesius
genannt, die ihm Vorbild waren und sein Werk maßgeblich
beeinflusst haben.
Auf dem Höhepunkt seines Schaffens entstand 1911/12 auf dem
Kladower Havelufer sein Sommerhaus, das er mitsamt der
Innenraumgestaltung und der Gartenanlage selbst geschaffen hatte
und dem er den launigen Namen Guckegönne gab, der sowohl die
fabelhafte Aussicht über die Havel wie die sächsische Heimat des
Architekten anklingen lässt.
Nach 1918 verschwand dieser wichtige Vertreter der deutschen
Architektur- und Wohnreform aus dem Blickfeld der
Architekturkritik und ist heute, obwohl sechzehn seiner Bauten in
der Berliner Denkmalliste vertreten sind, nur noch Fachleuten ein
Begriff.
Mehr ...
|
|
|
 |
|
Hans Stimman:
Stadthäuser.
Handbuch und Planungshilfe

Statt Wohnmaschine, Siedlungsbrei und sozialistischen
Architekturutopien fordert Hans Stimmann die Verteidigung der
historischen Stadtgrundrisse und damit die Kontinuität, Kohärenz
und Konvention des Städtischen. Die Baugeschichte des vergangenen
Jahrhunderts beschreibt der Autor als, mindestens seit den 20er
Jahren, „Verblassen des Alltagswissens um die Vielfalt städtischer
Häuser“ - energiesparender, ökologischer und schöner Häuser.
Bauhaus und Neues Bauen, die Architektur der DDR sowieso, seien
mit all ihren klangvollen Architektennamen nur episodische
Verirrungen, die, im Zuge der Nachkriegsmoderne, in West- und
Ostberlin „Freilichtmuseen für Architekturtouristen“ entstehen
ließen, wie das Hansaviertel und die Karl-Marx-Allee, die
hochhausbebaute Fischerinsel oder das Kulturforum mit den
Philharmonien und der Staatsbibliothek.
Diese nachvollziehbare und durchaus verbreitete
architekturästhetische Einschätzung polarisierte die mit der Stadt
verbundenen Architekten und initiierte das, was als Berliner
Architekturstreit in die Medien eingegangen ist.
Spätestens seit der bunten Bebauung des Friedrichswerders wird die
Entwicklung im Berliner Baugeschehen als Renaissance des
Stadthauses empfunden. Der mit reichem Bildmaterial, mit
Grundrissen, Querschnitten und Ansichtsskizzen brillierende und
mit kurzen programmatischen Texten bestückte Band liest sich wie
das Vermächtnis des ehemaligen Senatsbaudirektors. Sein Plädoyer
für die Vielfalt des städtischen Hauses unterscheidet vier Typen,
die in zahlreichen Beispielen vorgestellt werden: Stadthäuser als
Ensembles, Stadthäuser als Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser in
Baulücken, Stadtvillen. Ein fünftes, als „Bauteilkatalog“
überschriebenes Kapitel, beschränkt sich auf das exemplarische
Abbilden von Fassaden, Eingängen, Wohnräumen, Küchen, Badezimmern,
Treppenhäusern und Außenbereichen.
Im Unterschied zur Architekturdiskussion des vergangenen
Jahrhunderts scheint die soziale Frage in den Betrachtungen
Stimmanns keine Rolle mehr zu spielen. Seine Absicht, mit diesem
Buch im Sinne des Architekturkritikers, Werner Hegemann, zur
Schulung des Auges des Betrachters beizutragen, dürfte aber ohne
Zweifel aufgehen und auch der Hinweis auf die Eignung der
IBA-Häuser von Hinrich und Inken Baller, Alvaro Siza, Rem
Kohlhaas, Peter Eisenman oder Aldo Rossi als Trainingsprogramm für
Architekten kündet von den städtebaulich-ästhetischen Vorlieben
des Autors.
Mehr ...
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigrid Hoff:
Berlin. Weltkulturerbe / World
Cultural Heritage
Vom preußischen Arkadien bis zur Moderne
Deutsch /Englisch

Die seit
2008 als Weltkulturerbe eingetragenen sechs Großsiedlungen der
Berliner Moderne, die, zwischen den Kriegen, in der zweiten Hälfte
der 20er Jahre entstanden, 135 000 Wohnungen umfassten und
bautechnisch wie baukünstlerisch Weltbedeutung erlangten, sind für
viele, weil weniger bekannt und seltener besprochen, die
architektur- und sozialgeschichtliche Überraschung dieses
fotografisch reich ausgestatteten Bandes.
Nach den Schlössern und Gärten des 18. und 19. Jahrhunderts, die
das preußische Arkadien entlang der Havel formten, nach Peter
Joseph Lenné und Ludwig Persius würdigte die UNESCO die im 19. und
20. Jahrhundert entstandenen Kunst- und Archäologiesammlungen der
Museumsinsel und in Karl Friedrich Schinkel, Friedrich August
Stüler, Alfred Messel und Ludwig Hoffmann ihre namhaftesten
Baumeister.
Es ist das Verdienst dieses Buches die, neben diesen Kleinodien
der Berliner Kulturgeschichte, eher als Alltagsarchitektur
empfundenen Großsiedlungen – Gartenstadt Falkenberg, Siedlung
Schillerpark, Großsiedlung Britz, Wohnstadt Carl Legien, Weiße
Stadt, Großsiedlung Siemensstadt – in ihrer gewaltigen sozialen
und ästhetischen Bedeutung vorzustellen.
Mehr ... |
|
|
|
|
|
|
|
Karl Scheffler
"Die fetten
und die mageren Jahre"
Ein Arbeits- und Lebensbericht

Karl Scheffler (1869-1951) hat die Großen der Berliner Architektur-
und Kunstszene gekannt; ja er muss, nach seinen intimen Porträts zu
urteilen, bei ihnen ein- und ausgegangen sein. Etwa bei dem
Architekten und Designer Henry van de Velde, der im Berlin des
beginnenden 20. Jahrhunderts in fortschrittlichen Künstlerkreisen
ein Star war. Bei ihm zu Gast, saß man in seinen Möbeln, aß von
seinem Geschirr; selbst der Schmuck und Kleiderzierrat der
anwesenden Damen stammte aus seinen Werkstätten. Harry Graf Kessler,
Schriftsteller, Mäzen, Kulturpolitiker, Vizepräsident des Deutschen
Werkbundes und schließlich auch Propagandist der van de Veldeschen
Kunst, ließ sich von dem Belgier seine Wohnung in der Köthener
Straße einrichten, bis hin zu den einheitlichen Buchrücken. Unter
den aus großer Nähe geschilderten Architekten finden sich noch Peter
Behrens und Hans Poelzig, auch Heinrich Tessenow, dessen
Umgestaltung von Schinkels Neuer Wache im Detail berührend
geschildert wird, vor allem aber August Endell. Für den als leicht
verletzlich und misstrauisch beschriebenen Schöpfer der
Jugenstil-Fassaden in den Hackeschen Höfen, dessen Formen etwas
„Maurisches, Ostasiatisches und Hieroglyphisches“ hatten, hielt
Scheffler, der einer der wenigen war, die Zugang zu „diesem reinen,
unbequemen Menschen“ hatten, 1925 die Totenrede.
Mehr ... |
|
|
|
|
Dieter Hoffmann-Axthelm
Das Berliner Stadthaus.
Geschichte und Typologie. 1200 bis 2010

Eine Typologie des Berliner Stadthauses zu entwerfen, scheint,
angesichts der allgemein bekannten Armut der Stadt an historischer
Bausubstanz, ein überaus kühnes Unterfangen. Der Autor weiß es,
wagt es und hält dem Skeptiker entgegen, dass mit dem Abriss eines
Hauses das Bauwerk selbst verloren geht, aber nicht
notwendigerweise sein Typ. Wird sein Typus oder werden auch nur
einzelne, der ihn kennzeichnenden Züge, in jüngeren Bauschichten
bewahrt, ergibt sich daraus eine, auch für die Berliner
Verhältnisse, lohnende Perspektive historischer Erkundung.
Ein Beispiel sind die Seiten-, Hinter- und Gartenhäuser, Höfe,
Schuppen und Remisen. Diese rückwärtige Architekturlandschaft ist
Abbild älterer Bauformen, die in Folge verschiedener
Reglementierungen und Vereinheitlichungen des Straßenbildes in den
Rückraum der Häuser abgedrängt wurden. Die heute noch zu findenden
Beispiele mögen nur hundert oder hundertfünfzig Jahre alt sein,
tradieren aber eine Baukultur, die aus dem Spätmittelalter
herüberreicht.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Nadja Cholidis, Lutz
Martin (Herausgeber)
Tell Halaf
Im Krieg zerstörte Denkmäler und ihre Restaurierung

Im Alleingang betrieb Baron Max von Oppenheim die Entdeckung und
Ausgrabung des aramäischen Fürsten-sitzes vom Tell Halaf zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und führte seine engagierte Arbeit mit der
Gründung des eigenen Tell Halaf-Museums in der Charlottenburger
Franklinstraße fort. Um den Siedlungshügel Tell Halaf im
Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris entstand ab dem 2.
Jahrtausend v. Chr. die Stadt Guzana, in der heutigen syrischen
Provinz Al-Hasakah nahe der türkischen Grenze. Der Palast datiert
vom frühen 1. Jahrtausend v. Chr.
Oppenheims Museum wurde 1943 durch eine Fliegerbombe getroffen.
Feuer und Löschwasser taten ein Übriges, um die mühevoll
geborgenen Basaltstatuen, die mit zahlreichen Tierdarstellungen,
darunter Gazellen, Löwen, Stiere oder Strauße, versehenen
Orthostaten, die das Fundament der Palastmauern darstellten, das
Skorpionentor und die Kultgegenstände und Alltagswerkzeuge zu
zerstören.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Christian von
Steffelin:
Palast der Republik (1994-2010

Den Großen Saal, den Volkskammersaal, Erich Honeckers Büro, die
Galerie im Palast, die Foyerbar und das Palastrestaurant,
Bierstube, Weinstube und Spree-Bowling, Jugendtreff, Mokkabar und
Milchbar, Keller, Dachgeschoß, Foyer und Garderobe, ungezählte
Technik- und Konferenzräume … 700 000 Quadratmeter Palastfläche
hat der Fotograf minutiös eingefangen. Die Räume sind zunächst
leer und dann entkleidet, entkleidet von Möbeln, Teppichen,
Bildern, Wänden und Decken. Es bleibt das Skelett der Stahlträger
– in Nahaufnahme – und unvergesslich die in ihrer Nacktheit
grandiose Konstruktionslandschaft des Großen Saals, der in den
Zeiten der Zwischennutzung wieder bespielt, die Hoffnung aufkommen
ließ, dass doch noch etwas zu retten wäre, von „Erichs
Lampenladen“.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Celina Kress:
Adolf Sommerfeld / Andrew
Sommerfield (1886-1964)
Bauen für Berlin 1910-1970

Die Anfänge der Unternehmungen Adolf Sommerfelds (1886-1964) lagen
in der Hermannstraße in Rixdorf bei Berlin, das nach Erlangung des
Stadtrechtes 1899, in wenigen Jahren nahezu explosionsartig auf 237
000 Einwohner angewachsen war. Hier entstand 1910 die erste Firma
des jüdischen Bauunternehmers, der als Zimmermann begonnen hatte und
fortan, höchst erfolgreich, seinen Platz zwischen Handwerk,
Architektur und Industrie auslotete und dabei ein feines Gespür für
Krisen und Konjunkturen bewies.
Während des Ersten Weltkrieges machte er mit Holztragwerken für
Industriehallen, für die er in West- und Ostpreußen eigene Sägewerke
und Tischlereien betrieb und mit dem Bau von Massenunterkünften
hervorragende Geschäfte. Nach dem Krieg konnte er Aufträge zum Umbau
von Kriegsschiffen und für Reparations-Baumaßnahmen in Frankreich und
Belgien akquirieren.
Sommerfelds Privathaus, das 1920/21 nach Plänen von Walter Gropius und
Adolf Meyer auf dem Gelände der „Terraingesellschaft am Neuen
Botanischen Garten“ in Berlin-Lichterfelde entstand, an der er
selbst die Aktienmehrheit hielt, war das Luxusmodell eines
Blockhauses, das äußerlich wenig mit dem Neuen Bauen zu tun hatte.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Thorsten Dame:
Elektropolis Berlin.
Die Energie der Grosstadt

Berlins Weg zur Elektropolis, einem Weltzentrum der Elekroindustrie,
den Walter Rathenau, 1902, mit den Worten kommentierte, „Spreeathen
ist tot und Spreechicago wächst heran!“, lässt sich an der
entsprechenden Architekturlandschaft nachvollziehen, die im
wesentlichen in den letzten Jahren des 19. und im ersten Drittel des
20. Jahrhunderts entstanden ist. Ihre namhaftesten Baumeister sind
Franz Schwechten, dessen „Beamtentor“ für die Allgemeine
Elekticitäts-Gesellschaft (AEG) in der Brunnenstraße die
Gesellschaft selbst überlebt hat, Hans Heinrich Müller, der mit
seinen Berlin prägenden, expressiv-kathedralenartigen
Backsteinbauten, wie dem ehemaligen Bewag-Stützpunkt Christiania im
Wedding, den größten Anteil am Bauprogramm hatte und Peter Behrens,
dessen Turbinenhalle in der Huttenstraße als Ikone des industriellen
Bauens gilt und der über die Architektur hinaus vom Firmensignet
über die Gebrauchsgrafik und das
Produktdesign das gesamte Erscheinungsbild der AEG entwarf.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Matthias Wemhoff:
Der Berliner Skulpturenfund.
"Entartete Kunst" im Bombenschutt

Vor dem Roten Rathaus begann
im Januar 2010 eine archäologische Schatzsuche der besonderen
Art. Nicht neue Aufschlüsse über die Bau- und Siedlungsgeschichte
des mittelalterlichen Berlins
sondern elf nach archäologischen Maßstäben eher unspektakuläre, in
die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
zu datierende Steinguss-, Terrakotta- und Bronzefiguren,
beanspruchten die ganze Aufmerksamkeit der
Ausgräber. Mit Hilfe des Georg-Kolbe-Museums und der Forschungsstelle "Entartete
Kunst" an der FU
Berlin konnten die Skulpturen als Kunstwerke identifiziert werden,
die von den Nazis als Entartete Kunst
indiziert worden waren.
Das knapp 50-seitige, mit hervorragendem Fotomaterial ausgestattete
Heft, gibt die erschütternde
Wirkung der dem Bombenschutt und dem Vergessen entrissenen
Skulpturen wieder und geht den
Spuren ihrer Schöpfung und ihrer versuchten Zerstörung nach. Die
Skulpturen, darunter Marg Molls
Tänzerin oder Otto Freundlichs Kopf sind bis auf
weiteres im Griechischen Hof des Neuen Museums
zu sehen.
|
|
|
|
|
Dirk Schumann (Hg.):
Brandenburgische Franziskanerklöster
und norddeutsche Bettelordensbauten.
Architektur - Kunst - Denkmalpflege

Der mittelalterliche
Landesausbau in Brandenburg ist ohne die Rolle, die die Klöster
gespielt haben,
nicht zu denken. Die Ansiedlung der Bettelorden ab den 20er oder
30er Jahren des 13. Jahrhunderts,
betrieben vom Bischof von Brandenburg, von regionalen Adelsfamilien
und später auch von den Städten,
vollzog sich parallel zur Ausbreitung des Städtewesens in der Mark.
Eine Tagung in Gransee, einem dieser franziskanischen
Klosterstandorte in der Mark, die im Oktober 2007
Kunsthistoriker, Historiker, Archäologen, Restauratoren, Bauforscher
und Architekten zu einer Art historisch-
archäologischer Bestandsaufnahme versammelte, sollte auch die
heutige Funktion der Klosterbauten im
Stadtbild, ihre Denkmalwürdigkeit sowie die Möglichkeiten einer
Nutzung der vielfach stark beschädigten
Gebäude eruieren.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Katharina Lippold:
Berliner Terrakottakunst des 19. Jahrhunderts

Die Berliner Terrakottakunst,
eine Vermählung von Norddeutscher Backsteinarchitektur mit
italienischem
Kunstsinn, hat ihre großen künstlerischen Initiatoren in dem
Architekten Karl Friedrich Schinkel und dem
Bildhauer Christian Daniel Rauch. Die erste herausragende Werkstatt
entsteht, nach holländischer
Entwicklungshilfe im 17. und 18. Jahrhundert, in der Ofen- und
Tonwarenfabrik des Töpfers Johann Gottfried
Höhler und seines Mitarbeiters Tobias Christoph Feilner, der später
als „Vater“ des Berliner Kachelofens gilt,
und der zusammen mit Schinkel die preußische Terrakottakunst
begründet.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Susanna Brogi:
Der Tiergarten in Berlin - ein Ort der Geschichte.
Eine kultur- und literaturhistorische Untersuchung

Die Absicht dieser
Untersuchung ist es, den Tiergarten mit seiner unmittelbaren
Umgebung als sich durch
die Zeiten wandelndes gesellschaftspolitisches Tableau zu lesen. So
enthält der im Anhang befindliche
Bildteil auch kaum Landschaftsfotos von Berlins grüner Mitte
sondern neben Plänen vorwiegend Gemälde,
Zeichnungen und Fotos ihrer Skulpturen. Als größte und relativ
eindeutig lesbare Skulptur beansprucht die
Siegessäule, die auch das Cover des Bandes ziert, großen Raum,
ebenso wie der am Rande des Tiergartens
liegende Zoologische Garten, dessen nur wenig geschönter Geste der
Naturbeherrschung und des Leids der
gefangenen Kreatur Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht Der
Panther Ausdruck gibt.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Johann Sigismund Elsholtz:
Hortus Berolinensis.
Der Berliner Lustgarten
Liber Primus - Erstes Buch
(deutsch / lateinisch)

Die 1657 von dem Arzt und
Botaniker Johann Sigismund Elsholtz verfasste Schrift zum Hortus
Berolinensis,
die als wichtigste Quelle für die Geschichte des Berliner
Lustgartens gilt, liegt in der vorliegenden feinen
Ausgabe zum ersten Mal in gedruckter Form vor. Offensichtlich hatte
der Verfasser mit seinem Werk auch
weniger ein Buch als ein Bewerbungsschreiben im Sinn, denn
tatsächlich wurde Elsholtz von Friedrich Wilhelm
noch Ende des gleichen Jahres zum Vorsteher des Lustgartens und zu
seinem Leibmedicus ernannt.
Dieser erste, mit 19 ganzseitigen Abbildungen illustrierte Band
stellt den Garten und seine Bepflanzung in
allgemeiner Form vor, widmet sich im Detail den von dem Ingenieur
und Baumeister Johann Gregor Memhardt
geschaffenen architektonischen Zügen der Anlage und bespricht
ausführlich seine bildhauerische Gestaltung.
Der eigentliche Pflanzenkatalog des Lustgartens ist dem zweiten Buch
des Werkes vorbehalten.
|
|
|
|
|
Harald Bodenschatz, u. a. (Hg.):
Stadtvisionen 1910/2010.
Berlin, Paris, London, Chicago
100 Jahre Allgemeine Städtebau-Ausstellung in
Berlin

Eine Ausstellung zum
hundertsten Geburtstag einer Ausstellung? In der Hochschule für
die bildenden
Künste, der heutigen Universität der Künste, fand 1910
die Allgemeine Städtebau-Ausstellung statt,
ein Großereignis in der Welt der Architektur, das die damals
aktuellen Planungen für ein Groß-Berlin,
sowie die städtebauliche Entwicklung der Stadt seit dem 17.
Jahrhundert vorstellte. Die heutige Ausstellung
und der vorliegende Katalogband wollen nicht die historische
Entwicklung der letzten hundert Jahre
nachzeichnen, sondern zwei dezidierte Zeiträume des Städtebaus im
internationalen Kontext beleuchten.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Hans Stimmann:
Berliner Altstadt.
Von der DDR-Staatsmitte
zur Stadtmitte

Der Band ist der konservativen Stadtkritik Wolf
Jobst Siedlers verpflichtet, wie er sie in seinem Buch
Die gemordete Stadt prägnant dargelegt hat. Stimmanns
Fokus ist die Stadt der Handwerker,
Bürger
und Kaufleute in Alt-Berlin, Cölln und auf dem Friedrichswerder.
Die viel gerühmten
Townhouses
nahe des Außenministeriums zählt er zu den stadtbaulichen
Mitteln, um den
Geburtsorten Berlins
wieder
Inhalt und Form zu geben. Die im Buch
vorgestellten und besprochenen Beispiele
sind die
Gebiete um
den Werderschen Markt, den Molkenmarkt, den
Petriplatz und den Neuen Markt. Der
Ist-Zustand dieser auch archäologisch im Mittelpunkt stehenden
Stadtplätze wird in dem Band mit
historischen Plänen und Aufnahmen hergeleitet und möglichen
Zukunftsszenarien überblendet.
|
|
|
|
|
Th. Kellein, R. Grabner, F. von Richthofen (Hg.):
1968.
Die Große Unschuld

Als unschuldig und frech
bewertet der Band die Kunstaktionen, mit denen die Joseph Beuys,
Andy
Warhol, Louise Bourgeois, Eva Hesse oder Claes Oldenburg der
herrschenden Kunst auf der Nase
herumtrampelten und ihrer Kunst ein nahezu unbeschränktes
Wirkungsfeld erkämpften. Mehr als
300 Werke von 150 Künstlern und Künstlerinnen dokumentieren
länderübergreifend das Kunstgeschehen
in dem engen Zeitabschnitt zwischen der Gündung der Kommune 1 am 1.
Januar 1967 bis zur Wahl
Willy Brandts zum Bundeskanzler am 21. Oktober 1969. Das fast 600
Seiten starke Werk erschien zur
gleichnamigen Ausstellung in der Kunsthalle Bielefeld vom 15. März
bis 2. August 2009.
|
|
|
|
|
Michael Haas und Wiebke Krohn (Hg.):
Hanns Eisler.
Mensch und Masse
(deutsch / englisch)

Der Kommunist und Jude, der zusammen mit
Ernst Busch die Agitprop-Bewegung zwischen den
Kriegen begründete, musste nach 1933 Österreich und Europa verlassen
und wurde 1948, nachdem
er die Nationalhymne der DDR komponiert hatte, wegen
unamerikanischer Aktivitäten auch aus den
USA ausgewiesen. Hanns Eisler war Schüler von Arnold Schönberg und
bildete zusammen mit Bertolt
Brecht eine der fruchtbarsten künstlerischen Arbeitsgemeinschaften
des 20. Jahrhunderts. Er prägte wie
kein Anderer das Gesicht des öffentlichen Musiklebens der DDR und
behielt doch Zeit seines Lebens die
österreichische Staatsbürgerschaft. Vielleicht konnte er deshalb und
trotz seiner Widersprüche zum
Ostberliner Regime sagen, dass er sich nicht vorstellen könne, in
einem anderen Land zu leben oder zu
arbeiten. Das Jüdische Museum Wien präsentierte den Band als
Begleitbuch zu seiner Eisler-Ausstellung,
die Teil der den Wiener jüdischen Musikern gewidmeten Reihe Musik
des Aufbruchs war. Es schildert die
Lebensstationen Eislers und enthält eine CD mit zwölf Kompositionen
des Meisters.
|
|
|
|
|
H. Bodenschatz, J. Düwel, N. Gutschow, H. Stimmann:
Berlin und seine Bauten.
Teil I - Städtebau
bei:
DOM publishers
oder

Wegen seiner in dieser Zahl und
Aussagekraft einmaligen Sammlung von Plänen und Karten fällt der
mehrere Kilo schwere Abschlussband der 24 -bändigen Reihe Berlin
und seine Bauten ungewohnt
großformatig aus. Die nur wenige Jahrhunderte alte erhaltene
Baulandschaft der Stadt hat es zum Usus
werden lassen, Berlin in seiner städtebaulichen
Entwicklung erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wahrzunehmen. So auch in diesem Band.
Drei Zeitabschnitte werden
unterschieden: die 90er Jahre des
19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, die folgende Zeit
bis
1975, dem Europäischen Denkmalschutzjahr,
und die 70er Jahre bis heute.
In allen drei Perioden wurden Visionen eines Neuen Berlin
formuliert, wobei
der Vorrat an Neuem sichtlich begrenzt war. Das wird
deutlich durch die Aufnahme realisierter wie auch
ausgewählter nicht realisierter
Projekte in das Buch. So plante der Magistrat schon zum 700. Stadtgeburtstag,
1937, im
Nicolaiviertel eine Traditionsinsel, eine Planung, die tatsächlich erst 50 Jahre später von
Günther
Stahn
realisiert wurde. Oder die Fischerinsel - in einem
Entwurf von Ludwig Hilberseimer ist sie
schon 1932/33
mit
Hochhäusern bebaut, während der Dresdner
Hochschullehrer Rudolf Göpfert noch 1954
plante, den Kiez zu
erhalten, ganz im Sinne einer erst viel später
formulierten behutsamen Stadterneuerung. Zu den
besonders
beredten Quellen gehört etwa eine Bodenwertkarte von 1905, die das
westliche Zentrum, die Dorotheen- und
Friedrichstadt in den Bodenpreisen als erstklassig gegenüber dem
eher zweitklassigen östlichen Zentrum und
dem sehr breiten Preisspektrum in den Altstadtgebieten ausweist.
Auch die Erkenntnis, dass die wirklich großen
stadtplanerischen
Ideen auf die Schützenhilfe des Krieges
angewiesen waren oder von der mechanischen
Auflockerung
profitierten, wie Hans Scharoun die Wirkung der
Luftangriffe nannte, vermittelt dieser Band.
|
|
|
|
|
Andres Kilger:
Das Neue Museum, Berlin.
Der Bauzustand um 1990

Andres Kilger bietet mit seinen
schwarzweißen Fotografien einen Rückblick auf den Jahrzehnte
währenden Zustand, in dem dieses Denkmal unter den
spätklassizistischen Museumsbauten nach
dem Krieg verharrte. Die stark kriegsbeschädigte Ruine, von
ihrem Erbauer, Friedrich August Stüler,
als Ausstellungsort archäologischer Zeugnisse geplant, war
selbst zum archäologischen Terrain
geworden. Wunderbar erscheinen zur Zeit der Wiedereröffnung dieses
Hauses die hier dokumentierten,
überaus provisorisch, fast hilflos wirkenden Erhaltungsmaßnahmen,
die tatsächlich den Abriss des
Bauwerkes verhindert haben mögen. Durch das Ruinen- und
Baustellenambiente scheinen in
eindrucksvollen Fragmenten und Resten die ursprünglichen Räume und Gestaltungen
dieses Museums-
Klassikers hervor.
|
|
|
|
|
Deutsches Architektur Jahrbuch.
German Architecture Annual
20008 / 09
(deutsch / englisch)

Das
Kolumba-Kunstmuseum des Erzbistums Köln von Peter
Zumthor, das für dieses Jahrbuch neu
fotografiert wurde und für das ihn das Deutsche Architekturmuseum mit
seinem diesjährigen
Preis für Architektur
in Deutschland auszeichnete,
überstrahlt den ganzen Band. Überschwänglich
gelobt als Beitrag
gegen die zunehmende
Verspektakelung der Architektur scheint in Köln ein
Zusammenklang von Architektur, Museumskunst
und archäologischer Spurensuche gelungen zu sein,
der auch
Architekturkritiker ins Schwärmen geraten
lässt. Das als exquisites Journal gestaltete Jahrbuch
stellt die 22 besten
aktuellen Architektur-Projekte in
Deutschland vor, darunter mit der Sammlung Boros,
dem Wohnhaus E3 in
Prenzlauer Berg, dem
Galeriegebäude am Kupfergraben und der Grundschule
Schulzendorf auch
vier Berliner oder berlinnahe
Projekte. Auch die zweite aufgenommene Zumthor-Arbeit,
die Kapelle Bruder Klaus in Wachendorf, gehört zu den
Höhepunkten dieses Bandes.
Neben den von einer Jury ausgewählten Projekten bringt das Jahrbuch
zwei Essays (Junge Architekten in
Deutschland, China
jenseits der Despotendebatte)
und einige Arbeiten deutscher Architekten im Ausland.
|
|
|
|
|
Berger Bergmann und Gerhard Müller (Hg.):
Apollos Tempel in Berlin.
Vom Nationaltheater zum Konzerthaus am Gendarmenmarkt

Als sich nach dreijähriger Bauzeit am
26. Mai 1821 der Vorhang zur Eröffnungsveranstaltung in
Schinkels Schauspielhaus hob und den Blick auf einen vom Architekten
selbst gezeichneten Prospekt
mit dem neuen Gendarmenmarkt und seinem Haus zwischen den
Gontardschen Türmen freigab, sei
minutenlanger Jubel ausgebrochen. Das von Karl Friedrich Schinkel gebaute, von
Voltaire und Lessing
inspirierte
und von einer zahllosen Schar von Schauspielern, Regisseuren,
Sängern, Musikern und Dichtern
mit
künstlerischem Leben gefüllte Haus wird in dieser eindrucksvollen
Chronik vorgestellt. Einen der
großen
Namen in der jüngeren Geschichte, widersprüchlich genug als Intimus
Görings und Helfer bedrängter
Schauspielerkollegen, denjenigen Gustaf Gründgens, ruft Marcel
Reich-Ranicki in der einleitenden
Erinnerung auf. Ein anderer Großer, Leonard Bernstein, war der
erklärte Liebling des Ostberliner
Publikums.
Er dirigierte in dem von 1979 bis 1984 als Konzerthaus
wiedererstandenen Bauwerk sechs Konzerte und war
umschwärmt wie ein Rockstar. Etwa 250 Jahre und vier große
Etappen des Hauses und seiner Vorläufer
lässt der reich
illustrierte Band Revue passieren: Das Königliche
Nationaltheater (1786-1817), das Königliche
Schauspielhaus (1821-1918), das staatliche
Schauspielhaus (1919-1945) und das Konzerthaus
am
Gendarmenmarkt (1945-2008).
|
|
|
|
|
Heike Fuhlbrügge:
Joseph Beuys
und die anthropologische Landschaft

Spuren, die das Verhältnis von Mensch
und Natur im Werk Joseph Beuys' beleuchten, führen zurück
in
die Antike, die Renaissance, in die Romantik, zum deutschem
Idealismus und zur Anthroposophie
Rudolf Steiners. Tier, Pflanze und Erde erscheinen bei Beuys als
beseelte und leidensfähige Wesen,
Natur schließlich als Metapher für Verletzung überhaupt. Dass
Landschaft ...ein Organ des Menschen
sein soll, wünschte der Künstler und wie Schelling, sah er sie als
subjektive Seinslandschaft, die nur im
Auge des Betrachters Realität hat oder als personifizierte Natur,
als Individuum, als Du wie bei Novalis.
Die mit Naturmotive in den Zeichnungen untertitelte Arbeit
belegt, wie Beuys diese Sicht zeichnerisch
entwickelt hat und wie er unter Einbeziehung von archetypischen,
mythischen und magischen
Zusammenhängen die Kluft zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen
Natur und Geist zu überwinden
suchte. Sie ist auch ein materialreicher Führer zur Beuys'schen
Vision einer sozialen Plastik.
Was im Detail die anthropologische Qualität der Landschaft
stiftet - als Symbol des Denkens,
Spiegel
alchimistischer Substanzumwandlung, Raum schöpferischer
Potenz der Frau, Spiegel für die
Verletzung
der Natur, Heilmetapher, Projektion des Selbst, usw. -
bleibt bei der Fülle der angesprochenen Themen
und Aspekte oft notwendig knapp und stichwortartig. Hilfreich
für den Leser und, auch bei einer
Dissertation nicht eben unüblich
wäre die Übersetzung der fremdsprachigen
Zitate.
|
|
|
|
|
Robert Habel:
Alfred Messels Wertheimbauten in
Berlin.

Den berühmten Eckbau, wie den gesamten
Komplex des
Wertheim-Warenhauses am Potsdamer Platz
darf man als eines der
prominentesten Bauwerke der Berliner Architekturgeschichte
bezeichnen. Er hat
seinem Schöpfer
Kritikerurteile wie positive Katastrophe oder vollkommene
Modernität verbunden mit
vollkommener Eleganz
eingetragen und veranschaulicht wie kein anderes Gebäude Alfred
Messels die
aufregend zwittrige
Stellung des Architekten zwischen Moderne und der
Architekturtradition des 19.
Jahrhunderts.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Helmut Reuter, Birgit Schulte (Hg.):
Mies und das Neue Wohnen.
Räume - Möbel - Fotografie

Der großen Entwurfszeit zwischen 1927
und 1931, in der Ludwig Mies van der Rohes legendäre,
linienzugförmige Stahlrohr- und
Flachstahlmöbel entstanden, gehen 20 Jahre in seinem Werk
voraus, aus denen es zum Thema Möbelentwürfe kaum Nachrichten gibt. Mies
hat die Unterlagen,
die einen Einblick in die Möblierung der
Gebäude aus seiner konventionellen Werkphase geben
könnten, bewusst
vernichtet.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Heinz Reif (Hg.):
Berliner Villenleben.
Die Inszenierung bürgerlicher Wohnwelten
am grünen Rand der Stadt

Die östliche, proletarische
Mietskasernenstadt und das bessere westliche Berlin der
grünen Villensiedlungen,
der Berliner Osten und der Berliner Westen - was nach
schicksalsschweren Stichworten aus Klassenkampfzeiten
klingt, ist tatsächlich eine dem Stadtbild bis heute mit Mörtel und
Stein eingeprägte Wiederspiegelung der
Sozialstruktur seiner Bewohner. Berlin war nicht nur die
Mietskasernenstadt, es war zeitweise auch die größte
Villenstadt der Welt. Dieser Band geht den Fragen nach, welche
Erfahrungen, welche Motive und welche
Visionen hinter der Berliner Villen- und Landhausdynamik der Jahre
1860 bis 1914 standen und wie sich die
Attraktivität des Lebens im Einfamilienhaus am grünen Rand der
Stadt, trotz gravierender ökologischer und
ökonomischer Nachteile dieser Wohnform, bis heute erhalten hat. Das
Tiergartenviertel, die Villenkolonie
Grunewald, die Villenkolonie Lichterfelde, das Berliner Westend, die
Gartenstadt Frohnau und die
Villenkolonie
in Nikolassee sind die Stadträume, in denen sich die
hier im Detail und in zahlreichen Fotografien vorgestellte
bürgerliche Lebenswelt herausbildete. Lebenskunst und Lebensstil, Architektur,
Landschaftsgestaltung
und
Wohnkultur und ihre Ausdehnung in die Grandhotels des
wilhelminischen Berlins und bis in das Seebad
Heringsdorf, das als Berliner Villenkolonie an der Ostsee galt, sind die
Themen und Räume, an denen die
17 Autoren des Buches den Berliner Westen verorten und
nachweisen.
Der pflege- und nutzungsgeschichtliche Umgang dieser, wenn sie sich
in jüdischen Händen befunden hatten oft
auch herrenlosen
Denkmäler des Bürgertums während der
letzten 30 Jahre wird im Schlusskapitel behandelt. Ein
Orts- und
Personenregister und ein Verzeichnis der
Autoren beschließen den material- und
themenreichen Band.
|
|
|
|
|
Yvonne Al-Taie:
Daniel Libeskind.
Metaphern jüdischer Identität
im Post-Shoah-Zeitalter

Die Bedeutung der jüdischen
Kultur und Geschichte für das Werk Daniel Libeskinds steht im
Zentrum dieser
Untersuchung. Ist bei den Entwürfen für
Mahnmalsbauten oder jüdische Gemeindezentren
dieser Bezug
noch selbstverständlich, so müsste er es bei den
Museumsbauten des Architekten nicht sein. Entsprechend
kritische Kommentare fand Das Jüdische Museum Berlin, das von
manchem als Weltanschauungsarchitektur
oder
Architektur
mit zu stark narrativem Charakter bezeichnet wurde. Die Autorin
zeigt, dass sich die kulturelle
und religiöse
Metaphorik vor allem für die Berliner
Werkphase zwischen 1989 und Ende der 90er
Jahre
feststellen lässt und hier auch die nicht realisierten
Entwürfe einschließt. Am Beispiel des Masterplans, den
Libeskind für den Potsdamer Platz entworfen hat, macht Yvonne
Al-Taie auch die überreichen Literaturbezüge
in Libeskinds Arbeiten deutlich. Von dem poetischen Stil des
Wettbewerbstextes, über die Anleihe, die der
Architekt für sein Masterplankonzept
bei James Joyces literarischer Betrachtung der Stadt in Ulysses macht, bis
zum
Wortspiel mit Dub-lin und Ber-lin und dem zentralen Thema der
Abwesenheit
scheint der Architekt an
einem beständigen Dialog
zwischen architektonischem Konzept und mythologisch-dichterischem
Verstehen
zu arbeiten. Yvonne Al-Taie ist dem
Widerspruch zwischen dem konstruktiven Handwerk des Architekten und
der poetisch spekulierenden, sinnstiftenden Literatur über die
Architektur auf der Spur - und wo würde diese
Suche Erfolg versprechender sein als im Werk des
Architekturkünstlers Daniel Libeskind.
|
|
|
|
|
Klaus Honnef, u.a. (Hg.):
Liselotte Strelow.
Retrospektive 1908-1981

Liselotte Strelow hat mit ihrer Kamera
das öffentliche Bild der jungen Bundesrepublik und ihrer
Protagonisten
aus Politik, Kultur und Wirtschaft geformt. Die Fotografin erlernte
ihr Handwerk im Lette-Verein in Berlin und im
Atelier der berühmten Kinder- und Opernfotografin Suse Byk. Es
folgte ein typisch deutscher Karrieresprung: sie
übernahm 1938 das
Atelier ihrer ehemaligen jüdischen Chefin am Kurfürstendamm 230, als
diese Deutschland
verlassen musste. Nach dem Krieg wird
zunächst Detmold und dann Düsseldorf zu ihrem Lebensmittelpunkt. Der
zum 100. Geburtstag der Fotografin erscheinende Katalog will keine Parade
ihrer Meisterwerke
sein, sondern ihre
ästhetischen Vorstellungen und ihre methodischen Prinzipien veranschaulichen.
Vier Textteile - Die großen Porträts,
Technik
und Studio bei L. S, Zum theaterfotografischen Werk von L. S., und
L. S. - Porträt einer Porträtfotografin -
besprechen ausführlich Werk und Leben der Künstlerin. Herausragende
Aufnahmen, erscheinen ganzseitig, als
Tafeln, wie die Porträts von Marlene Dietrich und Gustav Gründgens,
von Gottfried Benn und Thomas Mann,
von
Konrad Adenauer, Kurt Schumacher oder die Profilaufnahme des
Bundespräsidenten Theodor Heuss, die
die
Vorlage für den Heuss-Briefmarkensatz lieferte. Die übrigen
Aufnahmen bilden, je zwei oder drei auf einer
Seite,
eine Galerie der Prominenz. Insgesamt stellt der Band auf 320
Seiten 282 Aufnahmen vor.
|
|
|
|
|
Iris Berndt:
Märkische Ansichten.
Die Provinz Brandenburg im
Bild der Druckgraphik 1550-1850

Es ist ein eigenes Vergnügen mit Hilfe
dieser Märkischen Ansichten die Entwicklung umzukehren. Die
längst
vertrauten Berliner
Stadtbezirke verwandeln sich wieder in kleine märkische Dörfer und ziehen sich in die
Naturlandschaft vor der Stadt zurück: Tempelhof
an den Fuß seiner Berge oder das Dörfchen Stralau auf das
jenseitige Spreeufer. Eine wunderschöne Radierung lässt den
Betrachter Dorf und Kirche hinter der mächtigen
Gestalt einer Weide am Treptower Ufer auf der anderen Flussseite
gerade noch ahnen.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Josephine Gabler:
August Gaul.
Das Werkverzeichnis der Skulpturen

August Gaul gilt als der Tier-Skulpteur
Berlins. Er war Meisterschüler des
Bildhauers Reinhold Begas und
Freund und Kegelbruder Heinrich
Zilles,
der einige Fotographien vom Frühwerk des Künstlers hinterlassen
hat. Die Tierplastiken Gauls, so die
Autorin
dieses akribisch erarbeiteten Werkverzeichnisses,
erfahren auch
heute noch im öffentlichen Raum eine
besondere Art der
Wertschätzung: Sie werden zwar gestohlen,
aber
nicht beschmiert.
Mehr
...
|
|
|
|
|
Ricky Burdett, Deyan Sudjic (Hg.):
The Endless City
(englisch)

Die Entwicklung der städtischen
Agglomerationen dieser Erde, ihre schiere Größe, ihre Probleme mit
Wasser-
und Energieversorgung, dem Schutz der Umwelt, der Sicherheit ihrer
Bürger beschwört alte Ängste herauf.
Deuten Megastädte wie Mumbai oder Sao Paulo auf ein Endstadium
der gegenwärtigen menschlichen
Zivilisation hin? Muss die Stadt, damit sie überleben kann und wir
in ihr, neu erfunden werden?
Mehr
...
|
|
|
|
|
C. Becker, C. Klonk, F. Schäfer, F. Solte (Hg.):
Metropolitan Views.
Kunstszenen Berlin London

Berlin macht als Szeneort, der mit relativ
günstigem Wohnraum und hohem Gebäudeleerstand
Künstler
aus
aller Welt anzieht, Schlagzeilen. Doch scheint
sich die Kulturpolitik der Stadt zunehmend
auf
dem
Mythos
ihrer alternativen Kunstszene auszuruhen. So weist Berlin
zwar einen hohen Grad an Kreativität und künstlerischer
Selbstorganisation auf, aber der offiziellen Kultur- und
Kunstpolitik mangelt es, ganz im Unterschied zu London,
an Impulsen und Ideen. Während
die
großen Museen hier mit ihren
Eintrittspreisen immer höhere Schwellen
schaffen, verzichten die Londoner Häuser ganz darauf. Wichtiger noch
ist der selbstbewusste Umgang mit der
Kunst als lebensnahem und nützlichen Produkt und damit
verbunden
die Uminterpretation der Institution
Museum in einen freundlichen Serviceanbieter. Sammeln,
Aufbewahren, Forschen, Ausstellen - das
waren
Museumstugenden von gestern. Heute zielen Museumskonzepte,
so das
Beispiel der Tate Modern, in Richtung
mulidisziplinärer,
interaktiver Erlebnisparks. In kurzen Artikeln und
Interviews bespricht der schwarzweiß illustrierte
Band fünf Themenbereiche: Staatliche Museen,
Kunstlaboratorien, alternative Ausstellungsräume,
Sammler und
Messen und Märkte. Das ist höchst interessant
zu
lesen und taugt mit seiner Sammlung der besprochenen Adressen
am
Ende des Buches auch als Leitfaden zum
kennen lernen der Kunstmilieus der beiden Metropolen.
|
|
|
|
|
Andreas Scholl, Gertrud Platz-Horster (Hg.):
Die Antikensammlung.
Altes Museum. Pergamonmuseum

Der Rundgang durch die griechische und
römische Welt der Berliner Antikensammlung mit ihren über 4000
Skulpturen wird auch zukünftig durch zwei Museen führen. Zwar werden
in einigen Jahren die Skulpturen aus
dem Nordflügel
des Pergamonmuseums mit denen im Alten Museum vereinigt, das dann
mit Sockel-, Haupt-
und Obergeschoss
nur diesem Sammlungszweck dienen wird, doch verbleiben die monumentalen Säle
mit
den Architekturen aus Pergamon,
Priene oder dem römischen Milet im Pergamonmuseum. Mit
der dritten,
vollständig
überarbeiteten und erweiterten Auflage dieses Leitfadens hält der Antikenfreund einen
Band in
den Händen,
der mehr als 160 Hauptwerke der in den letzten drei Jahrhunderten
nach Berlin gelangten
Sammlungsstücke in durchgängig neuen
Farbaufnahmen und kurzen, griffigen Texten vorstellt. Obwohl sich
heute allein aus der Antikensammlung noch Tausende von Objekten in
Russland befinden, so erinnern die
Herausgeber in ihrer Einleitung, verdankt die Berliner Sammlung ihre
Weltgeltung der Rückgabe des Großteils
der Berliner Antiken durch die Sowjetunion an die DDR im Jahre 1958.
|
|
|
|
|
Wita Noack:
Konzentrat der Moderne.
Das Landhaus Lemke
von Ludwig Mies van der Rohe

Das letzte,1932-1933, von Mies van der Rohe in
Europa realisierte Wohnhaus, das Landhaus Lemke, riskiert in der
Nachbarschaft der üppigen Villen am Hohenschönhausener Obersee
unbeachtet zu bleiben. Nur wer auf dieses
Fundstück vorbereitet ist, entdeckt die flachgedeckten,
eingeschossigen Backsteinkörper. Von der Gartenseite aus,
enthüllt sich der ganze Reiz des bescheidenen Hauses: Die Außenwände
sind in Glasflächen aufgelöst, so dass der
Blick nicht durch Mauern begrenzt wird. Wer von einem Zimmer durch
den dazwischen liegenden Hof hindurch in das
andere Zimmer schaut, nimmt alles, innen wie außen, als
ununterbrochene Flucht von Räumen wahr. Wie lange mag
der Architekt an dieser Durchsichtigkeit, an dem Ineinanderfließen
von Innen- und Außenraum, dem ungetrennten
Erlebnis von Wohnung, Garten und See gefeilt haben? Nach Kriegsende
wurde der Bau nacheinander als Lager und
Garage von der sowjetischen Armee und als Versorgungsstelle vom
Ministerium für Staatssicherheit missbraucht. Die
Schäden und baulichen Veränderungen dieser Zeit wurden 2000 bis 2002
in einer aufwendigen Sanierung behoben.
Auch der Hof- und Gartenraum, den Herta Hammbacher für den Bornimer
Betrieb des Pflanzenzüchters und Schriftstellers
Karl Foerster gestaltet hatte, ist wiederhergestellt worden. Vita
Noack, Bauhistorikerin und Autorin des Bandes, ist auch
die Herrin des Hauses, das seit 1990 unter dem Namen Mies van der
Rohe Haus als Kunsthaus des Bezirks Lichtenberg
genutzt wird. Ihre fotografisch reich dokumentierte und mit Liebe
zum Detail geschriebene Monographie setzt endlich
ein Gebäude ins Bild, das von der Mies-Forschung bisher eher
vernachlässigt wurde. Ein, dem Buch beigegebener
Fotoessay, der die Titel Struktur, Raum, Objekt trägt, vermag
es zudem, die innere Konzeption dieses Mies'schen
Bauwerkes in schöner Weise zu beleuchten.
|
|
|
|
|
Jens-Oliver Kempf:
Die Königliche Tierarzneischule
in Berlin von Carl Gotthard Langhans.

Das 1790 entstandene Anatomische Theater
oder korrekter, die Zootomie, ist das einzige erhalten gebliebene
Gebäude der Langhans'schen Tierarzneischule. Das frühklassizistische
Meisterwerk mit der Aura eines Tempels
der Wissenschaft verbirgt sich in einer parkähnlichen Anlage
zwischen Luisen- und Philippstraße, dem Deutschen
Theater und dem Charité-Hochhaus. Es ist ein zweigeschossiger,
villenartiger Bau mit flacher Kuppel und berühmt
für seinen
kreisrunden Hörsaal. Um einen mittleren, versenkbaren
Seziertisch steigen dicht gestellte, filigran verzierte
Bankreihen
steil bis unter die Kuppel und bewirken die Amphitheater-Assoziation.
Die Ausmalung der Kuppel mit
einem Freskenzyklus zur Tierhaltung stammt vom damaligen Direktor
der Königlichen Akademie der Künste, Bernhard
Rode. Carl Gotthard Langhans, der mit weiteren prominenten Bauwerken
wie dem Belvedere im Charlottenburger
Schlosspark, den Mohrenkolonnaden nahe des Gensdarmenmarktes
oder dem Brandenburger Tor im Berliner Stadtbild
zu bewundern ist, hat sein Anatomisches Theater älteren Vorbildern in Padua und Paris nachempfunden.
Und er hat es,
das ist unübersehbar, im Sinne der Stadtverschönerungsambitionen
seines Monarchen, Friedrich Wilhelm II., konzipiert.
Die detaillierte Baugeschichtliche Gebäudemonographie, so der Untertitel
des Bandes, geht auf eine Dissertation aus
dem Jahr 2005 zurück und erscheint pünktlich zum 200. Todesjahr des
Baumeisters. Das Buch ist zurückhaltend mit
historischen Stichen, Architekturzeichnungen und Meßbildaufnahmen schwarzweiß
illustriert. Leider fehlen aktuelle
Fotografien, die den
Fortgang der seit einigen Jahren andauernden Restaurierungsarbeiten
dokumentieren könnten;
der Stand der Restaurierung ist allerdings Gegenstand eines aktualisierenden Nachwortes. Eine schöne Zugabe sind
die
Quellentexte im Anhang mit Zeitzeugnissen aus der Bauzeit zu
Garten, Grundstück und Gebäude.
|
|
|
|
|
Ulrich Domröse:
Der Fotograf Herbert Tobias
1924-1982.
Blicke und Begehren

Herbert Tobias ist unter Kennern der
Berliner Fotografenszene der fünfziger Jahre eine Legende aber einem
breiteren Publikum kaum bekannt. Das mag an der erzwungenen
Einsamkeit eines Menschen liegen, der sich
in dieser für einen Fotokünstler und bekennenden Schwulen unseligen
Zeit verwirklichen musste. Der Katalog,
der zur Ausstellung Blicke und Begehren in der Berlinischen
Galerie (bis 25. August 08) erarbeitet wurde,
präsentiert das fotografische Werk unter Kapitelüberschriften, die
dem unkonventionellen Auftritt des Künstlers
entsprechen - Theatralische Inszenierungen, Posen, Einsamkeit,
Glück, Das Lied von der sexuellen Hörigkeit.
Spielende Kinder in der Nachkriegstrümmern Berlins,
grandiose Modeinszenierungen, erotische
Männerfotografien
und Porträts von Menschen wie Valeska Gert,
Andreas Baader, Amanda Lear, Zarah
Leander, Friedrich Schröder-
Sonnenstern, Klaus Kinski oder Hildegard
Knef bilden die Motivlandschaft von Herbert Tobias. Starke Signale
von
Melancholie, aber auch Kämpferisches geht von den Bildern aus.
|
|
|
|
|
P. Kahlfeldt, M. Caja, A. Gärtner, F. Neumeyer :
Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe war einer der
großen Architekturvisionäre des 20. Jahrhunderts. Viele seiner
Entwürfe blieben Vision, waren eher Projekte des Verstehens von
Architektur oder, wie das gläserne Hochhaus
an der Friedrichstraße bloßer Versuch, das Formproblem des
Hochhauses zu meistern. Selbst seine gebauten
Werke hatten, wie das berühmte Haus Thugendhat in Brünn, oft
Manifestcharakter. Der feine, fast vornehm
mit schwarzweißem Bildmaterial ausgestattete Band enthält vier
Aufsätze zur Idee und Praxis des Mies'schen
Bauens, zu seinen Berliner Jahren und zu seinem Werk, das nach 1938
in Amerika entstanden ist. Leider nur am
Rande erwähnt ist das 1932 in Berlin-Hohenschönhausen als Teil einer
Serie von Hofhäusern entstandene
Haus Lemke, das heute als Mies van der Rohe Haus das einzige
öffentlich zugängliche Privathaus des Architekten
ist. Der Erinnerungsband ist Teil einer Edition, die zivilen Helden
aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts,
Menschen, die Bedeutendes in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft und
Politik geleistet haben, ein Denkmal setzen will.
|
|
|
|
|
Ulrich Knufinke:
Bauwerke jüdischer Friedhöfe in
Deutschland

Jüdische Friedhofsbauten sind nach 1945,
wie andre jüdische Bauwerke auch, bis in die 80er Jahre hinein,
häufig ohne jede Dokumentation, abgerissen worden. Auch Berlin
bietet Beispiele für diese heute nur schwer
zu begreifende Praxis. Die vorliegende, mit dezentem schwarzweißen
Bildmaterial ausgestattete Untersuchung
ging aus einer Dissertation hervor und dokumentiert mehr als 280
erhaltene und zerstörte Bauwerke jüdischer
Friedhöfe vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die
unterschiedlichen Funktionsbauten - Taharahäuser,
Leichenhäuser, Trauerhallen - werden mit Blick auf den jüdischen
Bestattungsritus vorgestellt und der Stil-
und Gestaltwandel durch die Jahrhunderte betrachtet. Orts- und
Personenregister, eine selten umfangreiche
Bibliographie und eine stichwortartige, nach Bundesländern geordnete
Dokumentation der vom Verfasser
ermittelten Bauten beschließen den Band.
|
|
|
|
|
|
Adam Szymczyk und Elena Filipovic:
When things cast no shadow.
5. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst
(deutsch / englisch)

Das KW Institute for Contemporary Art,
die Neue Nationalgalerie, der Schinkel Pavillon und der
Skulpturenpark
Berlin_Zentrum, eine Innenstadtbrache südlich der Leipziger Straße,
die noch immer die jüngste Geschichte
der Stadt spiegelt, sind die Ausstellungsorte der 5. Biennale.
Gestik im sowjetischen Revolutionsfilm, Künstliche
Intelligenz, Staub in der Architektur, die Unterwelten Berlins,
Filme aus dem Balázs Béla Studio Budapest,
Fernsehen mit Jacques Lacan, Theater und Typografie oder Kosmologie
und Klangkunst heißen die Themen.
Der randvolle Katalog berichtet auf nahezu 600 Seiten über Inhalte
und Veranstaltungstage bis zum 15. Juni
2008 - auch über die Nächte, die unter dem Titel Mes nuits sont
plus belles que vos jours / Meine Nächte sind
schöner als eure Tage ein eigener Veranstaltungsteil sind.
|
|
|
|
|
|
Jim Rakete:
1/8 sec. Vertraute Fremde

153 prominente Einzelpersonen und
Gruppen, Schriftsteller, Musiker, Künstler, Sportler, Politiker,
Film- und
Fernsehleute, wurden für diesen Band und eine gleichnamige
Ausstellung portraitiert. Die meisten der vorwiegend
schwarzweißen, ganzseitigen Fotos entstanden 2007. Dabei nimmt der
Fotograf die widersprüchliche Wahrnehmung
öffentlicher Gesichter aufs Korn. Fremde Menschen, vertraut aus
täglichen Zeitungs- oder Fernsehbildern, überraschen
in dem Fotoband mit ungewohnt privaten, eher nichtöffentlichen
Gesichtern und Posen: Das albernde Trio Wim Wenders,
Otto Sander und Bruno
Ganz, Hans-Jürgen Wischnewskis altersweises Profil, eine
unergründliche Barbara Sukova,
die
Meret Becker-Serie oder der Willy Brandt-Schnappschuss aus dem Jahr 1965
mit Zigarette und Nelke - die Aufnahmen
zeigen eine Tiefe und Individualität, der man gerne nachblättert.
|
|
|
|
|
|
Manfred Reuther (Hg.):
Nolde in Berlin.
Tanz, Theater, Cabaret
(deutsch /
englisch)

Tanz-, Theater- und Cabaretszenen,
nächtliche Großstadtvergnügungen - der Katalogband stellt den nicht
so
bekannten Nolde vor, Berliner Motive, die 1910 und 1911 entstanden.
Schon 1889 kam der junge Nolde, damals
noch Emil Hansen, als Möbelschnitzer und Kunsthandwerker nach
Berlin. Ab 1905 verbrachte er in der Regel die
Wintermonate in der Stadt. Eigene Artikel des Bandes beschäftigen
sich mit Noldes Studien im Deutschem Theater -
Max Reinhardt hatte ihm allabendlich einen Platz in der Nähe des
Bühnenlichtes reserviert - und dem Thema des
Tanzes in seinem Werk, einem Motiv, dass in seinem Berliner Schaffen
in zahllosen Variationen wiederkehrt .
Der Katalog erschien zur
Eröffnungs-Ausstellung der Berliner
Dependance der Nolde Stiftung Seebüll in der
Jägerstraße am
Gendarmenmarkt.
|
|
|
|
|
|
Michael Roth, u.a.:
Matthias Grünewald.
Zeichnungen und Gemälde

Das Berliner Kupferstichkabinett ist in
der glücklichen Lage, mit 19 Zeichnungen auf 15 Blättern etwa die
Hälfte
aller Zeichnungen hüten zu können, die von Matthias Grünewald
erhalten sind. Die bis zum 8. Juni 2008 dauernde
Ausstellung
präsentiert erstmals nahezu alle bekannten graphischen Arbeiten des
Meisters der Frühen Neuzeit.
Biographische Angaben über den
Künstler, der im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert gewirkt hat,
sind, außer
dem Jahr seines Todes, 1528, rar. Die Ausstellung wie
der anspruchsvolle Katalog sind bemüht, die karge Daten-
und
Faktensammlung zum Leben Grünewalds in Verbindung mit den erhaltenen
Kunstwerken zu verdichten. Darüber
hinaus belegt der Katalog
eindrucksvoll den Zusammenhang des zeichnerischen Werks mit dem
malerischen Schaffen
Grünewalds. Die Zeichnungen waren oft Studien
für spätere Gemälde.
|
|
|
|
|
|
Kerstin Dörhöfer:
Shopping Malls und neue
Einkaufszentren.
Urbaner Wandel in Berlin

Zwischen 1992 und 2003 wurden
in Berlin 26 Shopping Malls gebaut. Unter den Stichworten Lage in
der Stadt,
äußere architektonische Erscheinung, Innenarchitektur und
Funktionalität, Ausstattung und Angebot und Publikums-
anziehung erfasst die Autorin die Qualität von zehn der neuartigen
urbanen Bautypen. Wie unterscheiden sich diese
Konsum- und Verführungstempel von schlichten Einkaufszentren?
Verändern die Shopping Malls die Stadtquartiere
oder assimilieren die Quartiere die Shopping Malls? Ist Shopping
schon Freizeitgestaltung oder kulturelle Aktivität
geworden? Die Untersuchung bietet interessante Antworten.
|
|
|

|
|
Claudia Feest (Hg):
Tanzfabrik.
Ein Berliner Modell im zeitgenössischen Tanz.
1978-1998

Mit
Aufnahmen, fulminant
und atemberaubend wie angehaltenes Leben und Arbeitstiteln wie Looping
- Flugversuche,
Der Maler des Raums wirft sich in die Leere oderWild wie Milch und
zobelsüß präsentiert dieser Jubiläumsband die
Tänzer-Choreographen der ersten
beiden Jahrzehnte. Die
Tanzfabrik, deren Wurzeln im Westberlin der siebziger Jahre
liegen, ist längst ein bedeutendes internationales Zentrum für
zeitgenössischen Tanz geworden und wird dieser Tage
dreißig. Den Geburtstag will sie mit 365 Tagen Unterricht, Aufführungen und Veranstaltungen feiern. Es
macht Spaß,
mit diesem Band einer wundervoll dynamischen Kulturinstitution
Berlins auf die Spur zu kommen.
|
|
|

|
|
Martin Roemers:
Trabant. Die letzten Tage der
Produktion.
Trabant. The Final Days of Production
(deutsch /
englisch)

Die
anlässlich der Ausstellung Arbeit und Alltag 1950-1992.
Fotografien von Roger Melis, Martin Roemers und
Walter Vogel im Willy-Brandt-Haus (Nov. 07 - Jan 08) erschienene Publikation schaut sich an
wie der fotografische
Abgesang auf ein Stück DDR-Identität. Der
Trabant-Schriftzug, der Cover und Umschlaginnenseiten des schmalen
Bandes ziert, könnte allerdings, als Klassiker des
DDR-Industriedesign, noch manche Auferstehung erleben. Vier
kurze Texte - "Der
Lebenslauf des PKW P50 Trabant", "Es war ein aufsehenerregendes Auto aus Duroplast", "Eine
verschwundene Lebenswelt in Schwarzweiß", "Die
letzten Tage der Produktion" - begleiten die 41 Aufnahmen.
|
|
|
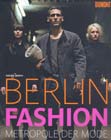
|
|
Nadine Barth:
Berlin Fashion.
Metropole der Mode

Zehn
Konfrontationen von Architektur- und Modeaufnahmen des Fotografen
Alexander Gnädinger
machen einen schönen Auftakt für den opulenten Band. Der
Hauptteil umfasst die Text- und Fotoporträts
von 46 Berliner Modedesign-Labels, von denen die große Mehrzahl
nach 2000 gegründet wurde. Berlin
als Dreh- und Angelpunkt von Mode und Kreativität wird, beginnend
mit dem Vorwort von Klaus Wowereit,
auf den 318 Seiten vielleicht etwas überstrapaziert. Erfrischend
aus der Reihe fällt da die Designerin Mari
Otberg: Die Stadt ist für mein Schaffen irrelevant. Ich bin
kein typischer Berliner Designer. Ich bin gerade
zufällig hier. Der knappe Anhang listet die Modeschulen der
Stadt und die Läden, in denen die vorgestellten
Labels zu finden sind.
|
|
|

|
|
Thorsten Scheer (Hg.):
Joseph Paul Kleihues.
Werke 1966-1980, Band 1

Dieser
erste Band einer mehrteilig angelegten Werkübersicht ist
von dem 2004 gestorbenen Architekten
noch selbst gestaltet worden. Er stellt das Frühwerk von Kleihues
vor, das in Berlin vor allem durch
seinen bedeutendsten
Industriebau, die Hauptwerkstatt der Berliner Stadtreinigung in
Tempelhof und das
Ergänzungshaus zum Krankenhaus Neukölln, das lange Haus der kurzen Wege,
repräsentiert ist. Viele
der dokumentierten Arbeiten sind Entwürfe und Projekte geblieben, wie die Arbeiten
für die Galerie- und
Museumsbauten in Düsseldorf und Hannover und die
Hausideen für die Künstlerfreunde Markus Lüpertz
und Georg
Baselitz, die den Baukünstler auf seinem Weg des Experimentierens mit einernarrativen
Architektur
zeigen. Große öffentliche
Bekanntheit erlangte Kleihues später in den 80ern als Planungsdirektor
der Internationalen Bauausstellung Berlin.
|
|
|

|
|
Azra Charbonnier:
Carl Heinrich Eduard Knoblauch.
1801 - 1865
Architekt des Bürgertums

Diese
Monographie rückt den Architekten ins Bewusstsein, der, selbst
kein Jude, dem deutschen
Judentum mit der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße eines
seiner bedeutendsten Bauwerke
schuf. Ein zweites erhaltenes Gebäude, das Jüdische Krankenhaus
in der Auguststraße, dokumentiert
das enge Verhältnis, das Knoblauch zur jüdischen Gemeinde der
Stadt unterhielt. Von der großen Zahl
städtischer Villen, Palais und Mietshäuser, die der erste
freischaffende Architekt Berlins baute, ist kaum
etwas erhalten. Eine biographische Spur führt ins Nicolaiviertel
zum Knoblauchhaus, seinem Geburtshaus.
Das eindrucksvolle Werkverzeichnis am Ende des Bandes gibt in Bild
und Schrift Auskunft über Knoblauchs
Schaffen auch über Berlin hinaus.
|
|
|

|
|
Kerstin Decker:
Paula Modersohn-Becker.
Eine Biographie

Paula
Modersohn-Becker und Rainer Maria Rilke wäre ein anderer,
möglicher Titel dieser
spannenden biographischen Recherche zweier Schwesterseelen.
Berlin, neben ihren Lebenspolen
Worpswede und Paris nur ein Zwischenspiel, lernt Paula Becker 1896
und 1901, zwischen Mal- und
Kochkurs kennen. Sie werde fromm in dieser unfrommem Stadt,
schreibt sie. Eine Schwäche des
Buches ist vielleicht der vertraulich spöttelnde Ton, mit dem die
Biographin die Weggefährten der Künstlerin
bedenkt, die Rilke, Clara Westhoff, Lou Andreas-Salomé, Otto
Modersohn ...
|
|
|
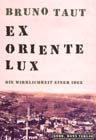
|
|
Manfred Speidel (Hg.):
Bruno Taut.
Ex Oriente Lux.
Die Wirklichkeit einer Idee

Der
Orient als Inspirationsquelle und Gegenrichtung zur europäischen
Kultur ist Thema dieser
Sammlung von Schriften, die zwischen 1904 und 1938 entstanden
sind. Auch während seiner
fruchtbaren Architektenjahre in Berlin hat Bruno Taut an der Suche
nach einer inneren Idee von
Architektur oder einer höheren Baulust, wie Paul
Scheerbarth es nannte, festgehalten. Forschungsziel
war eine nach sozialistischen wie esoterischen Ansätzen
weitgehend zweckentbundene, kosmische
Schönheit vermittelnde Architektur. Die Eindrücke, die Taut auf
seinen Reisen in die Sowjetunion und im
japanischen und türkischen Exil sammelte, wirken wie Splitter auf
der Suche nach einem einheitlichen Bild.
Illustriert ist der Band mit Beispielen sakraler Architektur aus
aller Welt, die die Tautschen Modelle und
Visionen inspiriert und beflügelt haben. Einige Aufsätze von
Adolf Behne, dem Kunsthistoriker und
Mitstreiter Tauts und eine sehr instruktive Einleitung hat der
Herausgeber dem Band beigefügt.
|
|
|

|
|
Landesdenkmal Berlin:
Gartendenkmale in Berlin.
Friedhöfe
online bestellen
bei

79
der 224 Berliner Friedhöfe sind als Einzeldenkmale in der
Gartendenkmalliste geführt und
Gegenstand dieser gewichtigen Publikation. Luftbildaufnahmen
und illustrierte Texte bezeugen
Landschaftsaspekt wie Wegeführung der einzelnen Anlagen und
die künstlerische und
gärtnerische Gestaltung ihrer Grabmale. Längst sind
Friedhöfe vor allem im urbanen Milieu
ihrem unmittelbaren Zweck entwachsen, sind zu Skulpturenparks
und inspirierenden
Erinnerungslandschaften geworden. Leider ist der schöne Band als
Spaziergangsbegleiter
nicht tauglich - sein Format und Gewicht würden jede Manteltasche
sprengen.
|
|
|

|
|
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, u.a.:
Kirchen des Mittelalters
in Brandenburg und Berlin.
Archäologie und Bauforschung
online bestellen
bei

Der
repräsentable und fotografisch reich ausgestattete Band
bietet die fächerübergreifende
Forschungsbilanz einer Tagung, die 2006 von der Berliner und
der Brandenburgischen Landesdenk-
malpflege veranstaltet wurde. Dorf-, Stadt- und
Klosterkirchen, aber auch Bischofskirchen, Burgkapellen
und Wallfahrtskirchen werden im Spiegel der Bauforschung und
archäologischer Untersuchungen
vorgestellt. Darunter sind 11 Berliner Stadt- und Dorfkirchen,
die Heilig-Geist-Kapelle und die Kirche
des Grauen Klosters aber auch prekäre Orte, wie die Kirche
des dem Braunkohletagebau geopferten
Dorfes Horno, aus deren Abriss Bauforscher und Archäologen
besonders tiefgehende Erkenntnisse
gewinnen konnten. Die Teilfinanzierung dieser Publikation
durch die Vattenfall AG in Cottbus ergänzt
hier aufschlussreich das Bild einer biederen
Landesdenkmalpflege.
|
|
|

|
|
Dana Menzel:
Der Architekt Adolf Wollenberg.
Leben und Werk

Der
Architekt Adolf Wollenberg ist ein Alfred Messel-Schüler. Seine
Spezialität wurden Villen mit
hochherrschaftlichem Aspekt für großbürgerliche Auftraggeber,
von denen im Charlottenburger
Westend und in Grunewald noch einige erhalten sind. Die Villa
Harteneck in der Douglasstraße in
Grunewald mit ihren denkmalgerecht wiederhergestellten und
öffentlich zugänglichen Gartenanlagen
gehört zu den eindrucksvollsten Hinterlassenschaften dieses
Architekten. Das Buch ist betont einfach
mit schwarzweißem Bildmaterial ausgestattet.
|
|
|

|
|
Anke Kuhrmann:
Der Palast der Republik.
Geschichte und Bedeutung des
Ost-Berliner Parlaments- und Kulturhauses
online bestellen
bei

Nach
all dem kurzfristigen ästhetisch-politischen Gezänk und dem
Event-Marathon der letzten Jahre, tut es
gut, etwas Grundsätzlicheres zum Palast zu erfahren. Die
vorliegende Monographie enthält eine detaillierte
Beschreibung und Analyse der Planungs-, Bau- und
Nutzungsgeschichte, die die große Bedeutung dieses
Bauwerks für die DDR-Architektur deutlich macht. Es bleibt
makaber, dass die Zunahme des Wissen um die
gesellschaftliche,
historische und architektonische Dimension des Palastes der
Republik mit dem
tatsächlichen
Schwinden,
der Abrissschau, einhergehen.
|
|
|
 |
|
Frank Schmitz:
Landhäuser in Berlin
1933-1945
online bestellen
bei

Dieser
detailreichen Studie ist der Herausgeber, das Landesdenkmalamt
Berlin, anzusehen. Der abschließende, 53
Häuser umfassende Katalogteil verleiht dem 400 Seiten starken Band die
Handhabbarkeit, die sich Architekten und
Denkmalpfleger wünschen dürften. Die Arbeit gilt den mehr als 30 000,
während der Zeit des Nationalsozialismus
in Berlin gebauten
Einfamilienhäusern. Es gab in dieser Baukategorie kein
vorgeschriebenes Musterhaus à la Carinhall
oder dem alpenländischen Motiven folgenden Haus von Leni Riefenstahl.
Das Flachdach verschwand als Stilelement
zwar weitgehend, dennoch konnte weiter modern gebaut werden, wie es
zahlreiche Häuser von Hans Scharoun,
Hermann Henselmann, den Brüdern Hans und Wassili Luckhardt
oder anderen bezeugen.
|
|
|
 |
|
Frank-Manuel Peter:
Das Berliner Hansaviertel
und die Interbau 1957
online bestellen
bei

Was
heute vielen als Fossil erscheint mit Wurzeln im Kalten Krieg
und auch als Architektur kalt geblieben,
war für das Westberlin der Nachkriegszeit ein
kulturpolitischer Höhepunkt: das Hansaviertel als westlicher
Gegenentwurf zu Ulbrichts Stalinallee. Der schmale Band
präsentiert fast privat zu nennende Schwarzweiß-
fotos um die Entstehung des Viertels. Wie Wochenschaubilder
rufen sie, mit leichtem Kribbeln beim Betrachter,
die Fünfziger in Erinnerung.
|
|
|

|
|
Cai Guo-Qiang:
Head on.
Sammlung Deutsche Bank
online bestellen bei

Die
vorgestellten Kunstwerke - 99 auf eine Glaswand zustürmende und
an ihr abprallende Wölfe, die
Schießpulver-Zeichnung Vortex und das Zwei-Kanal-Video Illusion
II - entstanden großenteils in Berlin
für die Ausstellung in der Deutschen Guggenheim Unter den Linden
von Ende August bis Mitte Oktober
2006. Der Katalog selbst kommt als Chinoiserie daher: in das Cover
des großformatigen Bandes ist eine
55-seitige Broschüre, das Foreplay, eingelassen, das
Materialien und Vorüberlegungen zum Projekt enthält.
Kunstproduktion à la Deutsche Bank? Beide, die Kunst wie der
Katalog, ächzen ein wenig unter den großen
Ambitionen des Geldinstituts.
|
|
|
 |
|
Gerwin Zohlen (Hg.):
Rudolf Fränkel,
die Gartenstadt Atlantic
und Berlin
online bestellen
bei

Die
zwischen 1925 und 1929 entstandene Gartenstadt Atlantic ist
ein Frühwerk Rudolf Fränkels.
Das Viertel, das sich zwischen die Behmstraße und die
Bellermannstraße im Wedding einfügt, hat
tatsächlich die Form eines Kuchenstückes, dessen Spitze ein
wirkungsvoller Kopfbau bildet. Ein
anderes bauliches Schmankerl war die für den jüdischen
Unternehmer und Kinopionier Karl Wolffsohn
geschaffene Lichtburg. Das Filmtheater strahlte mit seinem Lichtturm
weit nach Mitte hinein und fiel erst
1970 der Abrissbirne zum Opfer. Wer das 2001 bis 2005 fast
mustergültig sanierte Viertel durchwandert,
ist erstaunt über die hohe Qualität, mit der hier im Verhältnis
zum sozialen Wohnungsbau der Nachkriegs-
zeit gebaut wurde.
|
|
|
 |
|
Hans-Joachim Giersberg, Leo Seidel:
Preussens Glanz.
Königsschlösser in Berlin und Brandenburg
(deutsch / englisch)
online bestellen
bei

Dem
Fotografen Leo Seidel sind tages- und jahreszeitlich
variierende Aufnahmen mit ungewöhnlicher
Ausdruckskraft gelungen - 500 Jahre königliche Schlösser und
Anlagen neu belichtet. Auch die weniger
bekannten Bauten in Oranienburg und Caputh, in Königs
Wusterhausen und Paretz, in Lindstedt, Sacrow
und Berlin Schönhausen sind dokumentiert. Der ehemalige
Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin Brandenburg, Hans-Joachim Giersberg, hat
die Kurzbeschreibungen der Bauten und
die Bilderklärungen verfasst.
|
|
|
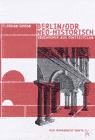 |
|
Florian Urban:
Berlin/DDR, neo-historisch.
Geschichte aus Fertigteilen
online bestellen
bei

Nicht
nur das Nicolaiviertel des Architekten Günter Stahn mit
seinem Gemisch aus wenigen historischen
Resten, alt geschminkten Plattenbauten und historische
Gebäude nachahmenden Neuschöpfungen ist
Ausdruck starker Historisierungsneigungen in der
DDR-Architektur. Florian Urban untersucht in seiner
äußerst lesbar geschriebenen Promotionsarbeit mit dem
Arnimplatz, der Spandauer Vorstadt, dem
Prenzlauer Berg und der Friedrichstraße weitere
neo-historische Städtebauprojekte Ostberlins. DDR-
Geschichts-Kitsch? Das Thema ist, wie der anstehende
Schlossneubau zeigt, komplizierter.
|
|
|

|
|
Steffen de Rudder:
Der Architekt Hugh Stubbins.
Amerikanische Moderne der
Fünfziger Jahre in Berlin

Mit
Funkturm, Brandenburger Tor und Gedächtniskirche war die
Kongreßhalle lange auf jeder Westberliner
Ansichtskarte zu finden und noch vor der
Amerika-Gedenk-Bibiliothek und dem gerade frisch renovierten
Henry-Ford-Bau der FU rangierte sie auf der Geschenkeliste der USA
an die Westberliner. Längst nicht mehr
und spätestens nach dem Einsturz des Daches, 1980, gilt der
amerikanische Beitrag zur Interbau, 1957,
als architektonisches Meisterwerk. Dennoch hat die Halle nach
mehrfacher Sanierung und als Haus der
Kulturen der Welt
ihren frostigen Frontstadt-Appeal verloren und steht selbstverständlicher an Ihrem prekären
Platz im Tiergarten als je zuvor.
|
|
|
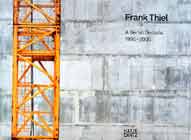
|
|
Frank Thiel:
Frank Thiel.
A Berlin Decade.
1995-2005
online bestellen bei

Die
Fotoarbeiten des Künstlers entstanden in den zehn Jahren, als
Großbaustellen der
bestimmende Wesenszug des Berliner Aufbruchs zu sein schienen. Die
überaus eindringlichen
Bilder - Muster und Strukturen, herausgelöst aus dem
alltäglichen Prozess städtischen Werdens
und Vergehens - lassen die Grenzen zu Malerei und Skulptur
verschwimmen. Der großartige
Fotoband wird begleitet von zwei Aufsätzen von David Moos (Utopische
Konstruktionen?) und
Robert Hobbs (Die erfasste Zeit) und ist die erste große
Monographie des Werkes von Frank Thiel.
|
|
|
 |
|
Landesdenkmalamt Berlin:
Kirchenruine des Grauen
Klosters
in Berlin.
Geschichte, Forschung, Restaurierung
online bestellen
bei

Der
minutiöse, reich bebilderte Report der fast fünfjährigen
interdisziplinären Forschungs- und Sanierungs-
arbeiten an der stimmungsvollen Klosterkirchenruine ist
eindrucksvoll, wenngleich man nicht umhin kann,
darüber zu sinnieren, dass der Sinn einer Ruine das Verfallen
ist. Aber keine Frage, diesen verschwiegenen,
und kulturell bespielten Ort lohnt es sich zu erhalten und mit
diesem Band hat er eine überaus schöne
Würdigung erfahren.
|
|
|

|
|
Ulrich Conrads:
Zeit des Labyrinths.
beobachten, nachdenken, feststellen.
1956-2006

Die
hier versammelten Aufsätze und Reden stammen aus dem Archiv des
Autors, das in der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus bewahrt wird.
Besonders reizvoll sind die von Ulrich Conrads
nachträglich zu
den einzelnen Beiträgen verfassten Kommentare, da das Buch sich
auf diese Weise wie
ein bauphilosophischer Spaziergang liest. Die
großen Akteure der Architektur des 20. Jahrhunderts und ihre
Werke werden leichthin und nach Bedarf auf die Szene gebeten.
|
|
|

|
|
Andreas Kitschke (Hrsg.):
Ludwig Ferdinand Hesse (1795-1876).
Hofarchitekt unter drei preußischen Königen

Ludwig Ferdinand Hesse
gehört zum Kreis der älteren Schinkel-Schüler. Er war nie der
Favorit der Könige,
unter denen er arbeitete und sein Werk stand immer im Schatten des
glanzvolleren Friedrich August Stüler.
In Berlin zeugen vor allem die Tierarzneischule an der
Luisenstraße und die Löwenbrücke im Tiergarten, in
Potsdam eine Vielzahl von Bauten und Kleinarchitekturen im Park
von Sanssouci und zahlreiche Villen von
der Hesseschen Architektur. Neben der Baukunst stellt die
umfangreiche Monographie auch die Möbel-
und Ausstattungsentwürfe und das bildkünstlerische Schaffen des
Architekten vor.
|
|
|
 |
|
Philipp Meuser:
Luftbildatlas Berlin-Mitte
Zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten
online bestellen
bei

In
neun Schritten oder Kapiteln durchmisst der Fotograf den Raum:
Alexanderplatz, Spreeinsel und
Friedrichswerder, Unter den Linden, Friedrichstraße, vom
Hackeschen Markt zur Charité, Regierungs-
und Parlamentsviertel, Potsdamer und Leipziger Platz, rund um
den Tiergarten, Zoologischer Garten und
City West. Jedes beginnt mit dem entsprechenden
Kartenausschnitt, in dem die folgenden Aufnahmen
markiert sind. 120 ganzseitige Luftbilder erheben den
Betrachter über die Stadt, ihm Einsichten in ihren
Plan gewährend, wie sie unten, im Gewirr der Straßen, nur
schwer zu gewinnen sind. Die Fotos sind
dem Band zusätzlich als CD-Rom beigegeben. Texte sind
allerdings, sieht man von zwei Seiten Einleitung
und zwei Seiten Ortsregister ab, völlige Fehlanzeige.
|
|
|

|
|
Regina Stephan (Hg.):
Erich Mendelsohn.
Wesen, Werk, Wirkung
online bestellen bei

Der
Band vereinigt die Beiträge zweier Erich Mendelsohn-Symposien in
Berlin und Manchester.
Experten, Zeitzeugen, Wegegefährten und Nachfahren folgen darin
den Spuren Erich Mendelsohns,
seinen Wanderungen zwischen den Kulturen und Kontinenten. Das mit
schwarz-weißen Fotos
ausgestattete, äußerst lesenswerte Buch schließt mit einer ausgewählten
Bibliographie, einem
Personenregister und einer Kurzbiographie des frühen
Stararchitekten, der im Laufe seines 66
Jahre währenden Lebens drei unterschiedliche
Staatsbürgerschaften besaß.
|
|
|

|
|
Antje Freiesleben, Johannes Modersohn:
Kritische Würdigung
der Kritischen Rekonstruktion
online bestellen bei

Unzweifelhaft
hat sich Hans Stimman in seinen 15 Jahren als Senatsbaudirektor
bleibende Verdienste
um das Berliner Stadtbild erworben. Doch ebenso sicher werden die
Baukünstler unter den Architekten
den selbstverliebten Beamten gern gehen sehen, zumal
Regula Lüscher Gmür, seine Nachfolgerin, als
deutlich mutiger und moderner gilt. Die in dem schmalen Band
gesammelten 71 Beiträge von Wegbegleitern
und Widersachern des Hans Stimman laufen auf eine Huldigung
hinaus. Die Stimmen derjenigen, die
unter dem engen Raster Stimmanscher Stadtvisionen gelitten haben, kommen etwas zu kurz.
|
|
|
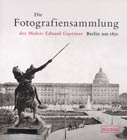
|
|
Stiftung Stadtmuseum Berlin (Hg.):
Die
Fotografiensammlung des Malers
Eduard Gaertner. Berlin um 1850
online bestellen bei

Die 77 Fotos
dieser Sammlung bezeugen die Anleihe, die der große Berliner
Vedutenmaler
bei dem Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts neu entstehenden
fotografischen Medium
und seinen Meistern nahm, hier vor allem Leopold Ahrendts und F. Albert Schwarz.
Dienten die
Fotos auch nicht als Vorlagen, so ist ihre motivische
Verwandtschaft mit den Stadtansichten des
Malers doch augenfällig. Zeughaus und Altes Museum, der
Lustgarten, die Neue Wache oder
verschiedene Denkmäler und Statuen gehörten sowohl zu den meist
fotografierten Objekten der
Zeit, wie auch zu den von Gaertner künstlerisch bearbeiteten
Motiven.
|
|
|
 |
|
Wolfgang Kreher, Ulrike Vedder (Hg.):
Von der Jägerstraße zum
Gendarmenmarkt.
Eine Kulturgeschichte aus der Berliner Friedrichstadt
online bestellen
bei

Der
Band widmet sich der 300-jährigen Kulturgeschichte der
Berliner Friedrichstadt, genauer der
Umgebung von Jägerstraße und Gendarmenmarkt mit ihren Menschen
und Institutionen, ihrem
tollen Gemisch prominenter Namen und Adressen. Lesenswerte
Artikel über Heinrich von Kleists
Berliner Abendblätter, Heinrich Heines Briefe aus
Berlin oder den Kunzischen Riß, eine verrückte
Skizze vom Gendarmenmarkt, die E.T.A. Hoffmann aus dem Fenster
seiner Wohnung fertigte,
wechseln
mit Mitteilungen über das Haus, in dem George Grosz geboren wurde, Bertolt Brechts
Intervention für
Ludwig Renn, das Urania-Theater, die Preußische Seehandlung, Rahel Varnhagens Salon, die
Dienst-
wohnung von Friedrich Schleiermacher, die Topographie in Theodor Fontanes Jenny Treibel
oder Walter
Felsensteins Komische Oper - alles in allem eine eindrucksvolle Fundgrube kulturgeschichtlicher Notizen,
Feuilletons und historischer Schwarzweiß-Aufnahmen.
|
|
|
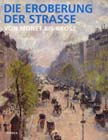
|
|
Karin Sagner, u.a. (Hg.):
Die Eroberung der
Strasse.
Von Monet bis Grosz
online bestellen bei

Der
Katalog dokumentiert eine Anfang September 06 in der Frankfurter
Schirn zu Ende
gegangene Ausstellung, in deren Mittelpunkt Paris, Walter
Benjamins Hauptstadt des 19.
Jahrhunderts, und Berlin, die in den Jahren der Weimarer
Republik modernste Stadt des
alten Kontinents stehen. Unter Titeln wie Urbane Inszenierung,
Mobilität und Technik,
Spektakel, Kommerz, Aufruhr und Boulevard und Straße:
Seele und Spiegel der Stadt
gelingt eine eindrucksvolle Schilderung der künstlerischen
Aneignung des städtischen
Lebens im 19. und 20. Jahrhundert. Warum diese Ausstellung nicht
in Berlin zu sehen war,
ist kaum nach zu vollziehen. Der sehens- und lesenswerte Band, der
mit der englischen
Übersetzung der Aufsätze schließt, ist eine willkommene
Entschädigung.
|
|
|
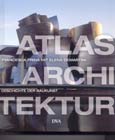 |
|
Francesca Prina, Elena Demartini:
Atlas Architektur.
Geschichte der Baukunst
online bestellen
bei

Exakter
beschrieben wäre der Titel mit Tausend Jahre abendländische
Baugeschichte. Innerhalb
dieser Grenzen dürfte der gewichtige, reich illustrierte Band
allerdings makellos sein. Helmut Jahns
Sony Center, die Forstersche Reichstagskuppel, das Jüdische
Museum von Daniel Liebeskind, Aldo
Rossis Quartier Schützenstraße, Frank O. Gehrys DG-Bank und
Hans Scharoun, Mies van der Rohe,
Hans Poelzig und Peter Behrens sind Bauten und Namen, die in
dem Handbuch der Epochen, Bau-
meister und Bauwerke das Kapitel der Berliner
Architekturgeschichte schreiben. Der Apparat zu dem
Band ist mit den Kurzbiographien bedeutender
Architekten, einem Glossar und einem Register der
Namen, Orte und Bauten vielleicht etwas knapp geraten.
|
|
|
 |
|
Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin:
Berlin und seine Bauten.
Stadttechnik
online bestellen
bei

Ein
Foto des 1925/26 von Walthar Klingenberg und Werner Issel
geschaffenen Großkraftwerkes
Klingenberg ziert den Umschlag der Stadttechnik, die
als Teil X, Band A (2) der renommierten Reihe
Berlin und seine Bauten erschienen ist. Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung, also die
gesamte
technische Infrastruktur der Stadt sind Thema des Buches und werden in gewohnter Weise mit
reichem schwarzweißen Bildmaterial und in ihrer historischen Entwicklung
geschildert. Das
Eingangskapitel behandelt die Geschichte der Gas-Straßenbeleuchtung und stellt die
verschiedenen
Leuchten, Laternen und Kandelaber vor.
|
|
|

|
|
Christoph Wagner (Hg.):
Das Bauhaus und die
Esoterik.
Johannes Itten, Wassily Kandinsky,
Paul Klee
online bestellen bei

Das
Bauhaus, das üblicher Weise mit Rationalität und Funktionalismus
assoziiert wird, hatte
vor allem in seinen frühen Jahren starke Affinitäten zu
esoterischen Zeitströmungen. Konzepte
der Lebensreform, Freimaurerei, Zahlen- und Farbenmystik,
Theosophie und Anthroposophie,
aber auch der Katholizismus waren wichtige Ideengeber, die über
die drei in diesem Katalogband
vorrangig behandelten Meister hinaus, die Produktion und
Kommunikation von Künstlern wie
Lothar Schreyer, Joost Schmidt, Karl Peter Röhl und Georg Muche
inspirierten. Alle Genannten
werden in ausführlichen Essays und dem, die Hälfte des Bandes
einnehmenden Bildteil vorgestellt.
Sie beleuchten damit einen wichtigen Aspekt der Genese des Bauhauses, der
bisher eher auf
Fußnoten und Randnotizen beschränkt war.
|
|
|
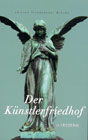 |
|
Helmut Pohren-Hartmann, Hermann Ebling:
Der Künstlerfriedhof in
Friedenau
online bestellen
bei
www.friedenauer-bruecke.de
Das
Grab Marlene Dietrichs macht die Friedenauer Anlage zu einem
ausgesprochenen
Besucher-Friedhof. Neben der großen Mimin sind andere hier
bestattete Prominente die Malerin
Jeanne Mammen, der Fotograf Helmut Newton und die
Schriftstellerin Dinah Nelken. Wer
in Friedenau wohnte und wirkte und künstlerische Bedeutung
erlangte - und das sind nicht
wenige - wurde von den Autoren in das ausführliche und reich
bebilderte Verzeichnis aufge-
nommen. Eine geschichtliche Einführung und eine
architekturhistorische Bewertung des Friedhofs
ergänzen den liebevoll gemachten Band.
|
|
|
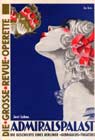 |
|
Jost Lehne:
Admiralspalast - Die
Geschichte
eines Berliner "Gebrauchs"Theaters
online bestellen
bei

95
Jahre nach seiner Eröffnung machte der Admiralspalast mit der
Dreigroschenoper, baulich
noch nicht wieder ganz der alte, auf sich aufmerksam. Revue,
Varieté und Operette waren hier
zu Hause; und später, in DDR-Zeiten, als Die Distel
und das Metropoltheater eingezogen waren,
Kabarett und Musical. Viel
Material wird aufgeblättert, Premieren und Umbauten
dukumentiert. Die
gewollt nüchterne, wenig inspirierte Sprache und der
fehlende Personenindex sind Schwächen
des Buches.
|
|
|

|
|
Myra Warhaftig:
Deutsche jüdische
Architekten
vor und nach 1933 - Das Lexikon
online bestellen bei

Die Autorin hat in
20-jähriger Arbeit an die 500 Portraits deutscher jüdischer
Architekten
zusammengetragen und sie ausdrücklich den Vergessenen, Verfolgten
und Ermordeten
unter ihnen gewidmet. So ist der mit schwarz-weißen Personen- und
Werkfotos versehene
Band vor allem der biographischen und beruflichen Rehabilitation
dieser Baumeister verpflichtet
und - in vielen Daten noch unvollständig - ein erster, wichtiger
Schritt in diese lange verdrängte
Region der Architekturgeschichte.
|
|
|
 |
|
Wolfgang Thöner, Peter Müller (Hg.):
Bauhaus Tradition und
DDR-Moderne.
Der Architekt Richard Paulick
online bestellen
bei

Der
Band ist als Katalog zu einer Wanderausstellung entstanden,
die das Leben und Werk
Richard Paulicks aus der Anonymität in das Licht der
Architekturgeschichte befördern möchte.
Paulick war in Dessau enger Mitarbeiter von Walter Gropius,
baute hier sein avantgardistisches
Stahlhaus, leitete während seiner fast 17-jährigen
Emigration in China das Stadtplanungsamt
von Shanghai und betreute in Hoyerswerda, Schwedt und
Halle-Neustadt den Aufbau ganzer
Städte. Sein Name ist auch maßgeblich mit der ersten
sozialistischen Straße Deutschlands, der
Stalinallee, heute Frankfurter Allee, verbunden, die
schon bald nach ihrer Fertigstellung ihren
Glanz verlor, zunehmend herunterkam, und nach der Wende -
verkehrte Welten - als kulturge-
schichtliches Ereignis gefeiert und saniert wurde.
|
|
|
 |
|
Roland Horn:
Berlin Hauptbahnhof
online bestellen
bei

Fotografierte
Ingenieurtechnik - der Band feiert eine europäische
Großbaustelle und Berlins
neuen mit vielen Superlativen angefüllten Hauptbahnhof. Es
ist nicht ganz klar, wie viel dieses
Bauwerk tatsächlich mit Reisen, mit Wegfahren und Ankommen zu
tun hat. Der Klappentext
begrüßt in ihm denn auch eher ein neues
Metropolen-Wahrzeichen und ein Aufsatz stellt ihn
in eine Reihe mit anderen europäischen und japanischen Bahnhofswelten
des ausgehenden 20.
und des beginnenden 21. Jahrhunderts. Immerhin erfährt der
Leser auch etwas zur Geschichte
des Ortes, zum Lehrter Bahnhof, dem Vorgängerbau des
Hauptbahnhofs.
|
|
|
 |
|
Ann Grünberg:
Erich Mendelsohns
Wohnhausbauten
online bestellen
bei

Die Wohnhäuser sind im Vergleich zu den spektakulären, vor
1933 entstandenen Kaufhaus-
und Gewerbebauten Erich Mendelsohns in der öffentlichen
Diskussion eher stiefmütterlich
behandelt worden. Und doch sind es gerade sie, die bis heute
weitgehend unbeschadet und
unverändert erhalten blieben und die die gesamte 40-jährige
Schaffenszeit des Architekten
bezeugen können. Den nach der Emigration in England,
Palästina und den USA gebauten
Häusern gehen die deutschen, vor allem Berliner Beispiele
voraus, darunter auch das eigene
Wohnhaus Mendelssohns am Rupenhorn in Charlottenburg.
Präzise, wenn auch etwas
schematisch aufgebaute Texte und ein fast 80 Seiten starker
Bildteil mit Schwarzweißfotos,
Skizzen und Grundrissen der beschriebenen Objekte beleuchten
diesen lange vernachlässigten
Werkausschnitt des großen
Baumeisters.
|
|
|
 |
|
Johannes Cramer, Ulrike Laible, Hans-Dieter Nägelke (Hg.):
Karl Friedrich Schinkel.
Führer zu seinen Bauten
online bestellen
bei

Der
zweiteilige Führer zu Schinkels Werk behandelt im ersten Band
Berlin und Potsdam und
folgt im zweiten den Spuren des Baumeisters, Baubeamten,
Städtebauers und Architektur-
lehrers von Aachen bis Sankt Petersburg. In die handlichen
Bändchen ist nur aufgenommen
was zweifelsfrei Schinkel ist; das aber dürfte komplett sein.
Für Berlin sind das neben Neuer
Wache, Schauspielhaus, Friedrichswerderscher Kirche oder Altem
Museum vor allem die
nördlichen Vorstadtkirchen und eine Anzahl von Grabmälern.
Alle Schinkelorte sind auf Plänen
in den Innenseiten der Umschlagklappen vermerkt - ein
äußerst nützlicher Führer für Freunde
des Baukünstlers. Allerdings würde man sich eine etwas
poetischere Sprache wünschen.
|
|
|

|
|
Astrit Schmidt-Burkhardt:
Stammbäume der
Kunst.
Zur Genealogie der Avantgarde
online bestellen bei

Die hier diskutierten Beispiele
der kunsthistorischen Systematisierung wie der
individuellen Selbstinszenierung reichen vom frühen 19.
Jahrhundert bis zu Künstlern
wie Anselm Kiefer oder Gerhard Merz, die unter dem vieldeutigen
Titel Deutsche
Gedenkstätten vorgestellt werden. Die Autorin hat ihrem Werk
eine beeindruckende
Sammlung von bildlichem Anschauungsmaterial, figürliche und
abstrakte Stammbäume,
Cluster, Diagramme, graphische Beziehungsmuster, die durchweg
selbst Kunstwerke
sind, beigegeben. Auch der umfangreiche Anmerkungsapparat ist,
ganz dem Verständnis
der Untersuchung dienend, ausgesprochen lehrreich und
erhellend.
|
|
|
 |
|
Burghard Ciesla:
Als der Osten durch den
Westen fuhr.
Die Geschichte der Deutschen Reichsbahn
in Westberlin
online bestellen
bei

Die
S-Bahn oder Stadtbahn in Westberlin war eine Merkwürdigkeit -
eine aus der Zeit und
aus der Form gefallene Zwischenwelt, die zeitweise von mehr
als 7000 westberliner
Eisenbahnern und Eisenbahnerinnen unterhalten wurde und unter
der Regie der Deutschen
Reichsbahn der DDR stand. Der ebenso unterhaltsame wie informative
Bericht über den
Kalten Krieg auf Schienen schildert den sozialistischen
Staatsbetrieb an Stichworten wie
Viermächte-Abkommen, Arbeitskämpfe, Sozialistische
Einheitspartei Westberlins, dem
Mauerbau, dem S-Bahn-Boykott, der Studentenbewegung ...
Einzige Schwäche des Bandes
ist die etwas karge Bildausstattung.
|
|
|
 |
|
Eva-Maria Barkhofen:
Ost-Berlin und seine Bauten.
Fotografien 1945-1990
online bestellen
bei

Der
Bildband bietet eine erste, tatsächlich einzigartige
Auswertung von Plänen, Skizzen,
Modellen und Fotos aus dem Fotoarchiv der Ostberliner
Bauverwaltung, das 1991 in die
Architektursammlung der Berlinischen Galerie übernommen
wurde. Die vielfach bisher
unveröffentlichten Dokumente sind in Verbindung mit dem sich
an die berühmte Reihe
Berlin und seine Bauten anlehnenden Titel eine
überfällige Mahnung, die Baugeschichte
der Hauptstadt der nicht mehr existierenden DDR wahrzunehmen
und zu dokumentieren.
|
|
|

|
|
Kerstin Dörhöfer:
Pionierinnen in der
Architektur
Eine Baugeschichte der Moderne
online bestellen bei

Emilie Winkelmann, die erste
deutsche Architektin, versteckte ihren Vornamen hinter
dem Kürzel E.; eine jüngere Kollegin, Paula Maria Canthal,
ersetzte ihn kurzerhand
durch das männliche Paul. Viele Stifterinnen einer
weiblichen Tradition in der
Architektur hatten ihr Wirken an die Arbeit ihrer Ehemänner oder
männlichen Kollegen
gebunden, wie Marlene Poelzig, die Frau von Hans Poelzig oder
Lilly Reich als enge
Mitarbeiterin von Mies van der Rohe. Der Fokus dieser
Untersuchung, die nur ein erster
Schritt in das komplexe Thema einer weiblichen Architekturszene
ist, liegt auf Berlin und
den Architekturarbeiten von Frauen, die zwischen 1907 und 1949
entstanden sind.
|
|
|
 |
|
Esther Levine:
Berlin - the urban photo
project
(deutsch /
englisch)
online bestellen
bei

Der
schön, fast ein bisschen preziös gemachte, knapp 10 x 13 cm große
Minifotoband
beginnt mit dem
Palast der Republik und endet mit einem unscharfen, davonfahrenden
Trabi - dazwischen sind weitere 236 Fotos, die reportagehaft
in den Alltag blicken. Keinerlei
Text stört die Bilderfolge. Erst am Ende informiert Dunja
Christochowitz auf drei Seiten über
die deutsche, in New York lebende Fotografin, deren
Berlinbilder auf wiederholten Besuchen
in der Stadt seit 1999 entstanden sind.
|
|
|
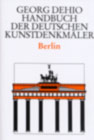 |
|
Georg Dehio:
Handbuch der deutschen
Kunstdenkmäler. Berlin
online bestellen
bei

Der
Dehio Berlin, ist eine komplette Denkmalstopographie der
Stadt, die Werke der
Architektur, Plastik, Malerei und des Kunsthandwerkes
einschließt. Ein Künstler-, ein
Objekt- und ein Straßenregister bilden das Raster, mit dem
Fachmann wie Laie Berlin
auf der Suche nach seinen Schätzen durchkämmen kann. Die auf
über 700 Seiten
angewachsene dritte Auflage des Bandes ist wie ihrer
Vorgänger frei von Fotos - nur
Stadtpläne und Grundrisszeichnungen ergänzen die knappen
kunsthistorischen Einträge.
|
|
|
 |
|
Petra Schmidt, Annette Tietenberg, Ralf Wollheim (Hg.):
Patterns. Muster in Design,
Kunst und Architektur
online bestellen
bei

Jahrzehnte
lang stand das Ornament als überflüssig bis süßlich auf
dem Index der
Gestaltungskunst. Dass Architekten, Künstler und Designer
dabei sind, sich von Bauhaus-
Losungen wie Weniger ist mehr zu befreien oder sie neu
zu interpretieren zeigt dieser
gewichtige Übersichtsband. Gattungsübergreifend präsentiert
er die crème der inter-
nationalen Gestaltung in alphabetischer Reihenfolge. Berlin
selbst ist in dem Buch mit
der Indischen Botschaft von Léon Wohlhage Wernik, der
Waldsiedlung von Nägeli
Architekten, zwei Bauten von Sauerbruch und Hutton und einer
Anzahl von Kunstwerken
vertreten, unter denen Stefanie Bürkles Berliner Tapete
auffällt, eine Anleihe der Künstlerin
aus dem Palast der Republik, die Design-Archäologie-Preis
verdächtig ist.
|
|
|
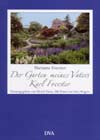 |
|
Marianne Foerster:
Der Garten meines Vaters Karl
Foerster.
Bornimer Gartentagebuch für Neugierige
online bestellen
bei

Schwarzweiß-Fotos
aus dem Familienalbum dokumentieren die Anfänge des Bornimer
Gartens. Die Tochter des großen Gartengestalters,
Pflanzenzüchters und Autoren setzt
zusammen mit dem Fotografen Gary Rogers den Wohnort und das
Werk Karl Foersters
ins Bild: Senkgarten, Frühlingsweg, Herbstbeet und
Steingarten, die sieben Jahreszeiten
des Gärtners und herausragend unter den Blütenschätzen,
Phlox und Rittersporn, die
Pflanzenlieblinge des Meisters. Die Darstellung dieses fast
100-jährigen, ungewöhnlich
intimen Wohn- und Gartenortes hat sich die Auszeichnung Gartenbuch
des Jahres 2006
verdient.
|
|
|
 |
|
Landesdenkmalamt Berlin:
Denkmale in Berlin. Bezirk
Mitte.
Ortsteile Moabit, Hansaviertel und
Tiergarten
online bestellen
bei

Im
Mittelpunkt des dritten Bandes zum Großbezirk Mitte stehen
Berlins schönster Park,
der Tiergarten, der Zoologische Garten, das Kulturforum oder
das aus der Interbau
1957 hervorgegangene Hansaviertel. Bemerkenswerte Einzelstücke
sind die Villa
von der Heydt, der Bendlerbock mit der Gedenkstätte Deutscher
Widerstand, die vielen
Moabiter Industriedenkmale, der Hamburger Bahnhof, das
ehemalige Shellhaus... Dem
mit seinen historischen und aktuellen Fotos schön zu
blätternden Band fehlt nur eins:
eine weniger sachliche Sprache, die auch das Lesen zum Vergnügen machen würde.
|
|
|

|
|
Jörg Probst:
Adolph von Menzel.
Die Skizzenbücher
online bestellen bei

Zum 100. Todestag des Malers
erscheint dieser erste Versuch, sich seines mehrere
tausend Blätter zählenden Skizzenschatzes anzunehmen.
Zeitgenossen haben Menzels
akribische Alles-Zeichnerei mit Herablassung wahrgenommen, sie gar
krankhaft genannt.
Der Autor stellt charakteristische Motivgruppen zusammen und
assoziiert sie mit den skurilen
Lebensgewohnheiten des Meisters und der Wissenslandschaft des
Biedermeier. Das
sprachlich gelungene Hineinhorchen in die Skizzen und die
Umstände ihrer Entstehung macht
neugierig auf mehr von diesen im Besitz der Berliner
Nationalgalerie befindlichen Zeichnungen.
|
|
|
 |
|
Franziska Bollerey:
Mythos Metropolis
(deutsch /
englisch)
online bestellen
bei

Der
Metropolenmythos, wie ihn Schriftsteller, Maler oder
Regisseure zu fassen suchen
und wie ihn Stadtwerbung selbst in Szene setzt, ist Thema
dieses schönen Bandes.
Buchillustrationen, Fotomontagen, Gemälde, Plakate, Fotos,
Film-Standbilder und Texte
gewähren Schicht um Schicht geheime Blicke auf Berlin, New
York, Paris und andere
Weltstädte.
|
|
|
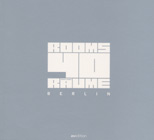 |
|
Kirsten Alda, Julia Stoffregen
Markus Brodbeck (Hrsg.), Darius Ramazani (Hrsg.):
40 Räume Berlin
(deutsch /
englisch)
online bestellen
bei

Lofts,
Shops, Showrooms, Clubs, Restaurants und Museen sind in
Kapitel angeordnet, die
Intim, Aktiv und Urban heißen. Die Orte sind fotografisch eindrucksvoll
inszeniert und mit
kurzen, knackigen Texten und Zugänglichkeits-Hinweisen versehen - ein
feines Handbuch
für
Fans von Innenarchitektur und Design, würden die Adressen-Angaben
nicht komplett
fehlen. Manchmal werden noch Straßen, oft nur der Bezirk erwähnt...?
|
|
|
 |
|
Peter Zöch, Gesa Loschwitz (Hrsg.):
Europäische
Landschaftsarchitektur.
Ausgewählte Projekte von 2000 bis heute
(deutsch /
englisch)
online bestellen
bei

Parks
und Gärten, Städtische Freiräume, Promenaden am Meer und
Orte der Erinnerung
sind die vier Abteilungen des Bandes überschrieben. Berlin
ist mit einigen Freiflächen des
Regierungsviertels, dem Tilla-Durieux-Park am Potsdamer
Platz und dem Denkmal für die
ermordeten Juden Europas vertreten, dazu noch, in der
Nachbarschaft, der Waldpark
Schragen in Potsdam. Dass einige der 60 vorgestellten
Projekte aus 13 Ländern noch etwas
unfertig wirken, dürfte in der Natur der Sache liegen. Der
Zeitraum von fünf Jahren taugt für
die Vorstellung von Projektideen, für die Präsentation der
Landschaftsergebnisse ist er zu
kurz gegriffen.
|
|
|
 |
|
Nathanja Hüttenmeister, Christiane E. Müller:
Umstrittene Räume: Jüdische
Friedhöfe in Berlin
online bestellen
bei

Der
Band stellt die zwei älteren der bekannten jüdischen
Friedhöfe in Berlin vor: die in der
NS-Zeit zerstörte Anlage in der Großen Hamburger Straße und
den Friedhof in der Schönhauser
Allee, dessen Steine der Verwitterung zum Opfer zu fallen
drohen. Kurioserweise wissen wir
über den zerstörten, aber schon früh in seinen Inschriften
dokumentierten Guten Ort in Mitte weit
mehr als über denjenigen in Prenzlauer Berg, der zwar fast
vollständig erhalten ist, bei den
Historikern jedoch lange unbeachtet blieb. Die Autorinnen
machen die Dringlichkeit einer wissen-
schaftlichen Erschließung der kulturhistorischen Schätze,
die jüdische Begräbnisstätten darstellen,
offenbar.
|
|
|
 |
|
Katrin Lesser, Klaus-Henning von Krosigk u.a.:
Gartendenkmale in Berlin.
Privatgärten
online bestellen
bei

Der
21. Band der Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin ist
ein herrlicher Führer zu den
eindrucksvollen Resten großbürgerlicher Gartenbaukultur, die
sich zumeist in Charlottenburg
oder Zehlendorf finden. Unter den mehr als 150 vorgestellten,
aufwendig fotografierten
Privatgärten sind etliche, die auch
öffentlich zugänglich sind, wie der Hartenecksche Garten
in der Douglasstraße, der Hannah-Höch-Garten in Heiligensee
oder Carl Bolles Marienhain in
der Wendenschloßstraße. Zwanzig der Gartenschöpfer sind
bekannt. Ihre Porträts, ein-
schließlich der sicher nicht ganz vollständigen
Werkverzeichnisse, beschließen das schöne
Werk.
|
|
|
 |
|
Roland Albrecht:
Museum der Unerhörten
Dinge
online bestellen
bei

Vierundzwanzig
Geschichten von unerhörten Dingen enthält das hübsche
Bändchen.
Ihre materiellen Zeugen, die Dichter und Künstler wie Walter
Benjamin und Thomas Mann,
Joseph Beuys, Béla Bartók oder Francesco Petrarca ins Spiel
bringen, hat der Autor in
in der Crellestraße gesammelt - sicher einem der
ungewöhnlichsten Museumsorte Berlins.
|
|
|
 |
|
Angela Hohmann, Imke Ehlers:
Berlin Contemporary.
Galerienführer Berlin
online bestellen
bei

Siebzig,
meist zweiseitige Galerienporträts geben einen Eindruck von
der Dynamik, die
der Handel und die Produktion von Gegenwartskunst im Berlin
der Nachwendezeit entwickelt
haben. Die
Galerienszene profitierte vom Esprit unkonventioneller Orte
und alternativer Kunst-
projekte und verließ das angestammte Charlottenburg zugunsten
von Zimmer-, August- oder
Sophienstraße in Mitte. Heute jedoch ist auch hier im
wesentlichen kommerzielle Normalität
zu Hause.
|
|
|
 |
|
Annegret Burg (Hrsg.):
Bau und Raum.
Jahrbuch 2005
(deutsch /
englisch)
online bestellen
bei

Mit
eindrucksvollem Fotomaterial dokumentiert das Bundesamt für
Bauwesen und Raum-
ordnung seine hochkarätigen Berliner Museumsprojekte:
Restaurierung und Erneuerung
des Neuen Museums, des Museums für Vor- und Frühgeschichte,
des Münzkabinetts und
des Zeughauses. Außerdem bespricht und bebildert der Band
Umbauten im Schloss
Niederschönhausen, Ministeriumsneubauten, die Umwandlung des
ehemaligen Kdf-Seebad-
Projektes in Prora auf Rügen in eine Jugendherberge und
verschiedene Botschafts- und
Schulneubauten im Ausland.
|
|
|
 |
|
Dörte Döhl:
Ludwig Hoffmann.
Bauen für Berlin 1896-1924
online bestellen
bei

Märkisches
Museum, Pergamonmuseum, das Stadthaus sind nur die
bekannteren unter
der Vielzahl von Bauten - Schulen, Krankenhäuser,
Amtsgebäude, Badeanstalten,
Brücken, Brunnen, Denkmale -, die der Berliner Stadtbaurat geschaffen
hat. Der umfängliche
Band schildert Hoffmann in seiner Zeit und seinen Konflikten
und glänzt besonders mit dem
vollständigen Werkverzeichnis, in dem auch zerstörte und selten abgebildete Bauwerke wie
der Komplex aus
Feuerwache, Standesamt und Untersuchungsamt im alten Fischerkiez mit
Fotos nachgewiesen
sind. Ein wichtiges Buch zu einem der wichtigsten Architekten
der Stadt
und seinen Architekturen, denen der Stadtwanderer noch
auf Schritt und Tritt begegnen kann.
|
|
|
 |
|
Ingrid
Scheurmann (Hrsg.):
Zeitschichten.
Erkennen und Erhalten.
Denkmalpflege in Deutschland
online bestellen
bei

Der
gewichtige Katalogband erscheint zur gleichnamigen Ausstellung
im Dresdner
Residenzschloss und feiert Georg Dehio, den Wegbereiter der
modernen Denkmalpflege.
Die Autoren untersuchen und bebildern den Wandel der Maximen,
unter denen Denkmale
gepflegt und erhalten wurden. Angesichts westdeutscher
Siegermentalität im Umgang mit
Baudenkmalen der DDR wird, etwa am Beispiel des
Ahornblatts auf der Fischerinsel in
Berlin-Mitte, auch die Frage von Denkmalschutz oder Denkmalsturz
thematisiert.
|
|
|
 |
|
Wolfgang Knauft:
Fabriken, Kapellen und KZ.
Französische Untergrundseelsorge
in Berlin 1943-1945
online bestellen
bei

Anfang
1943 begann das Wagnis der französischen Untergrundkirche in
Deutschland.
Als Arbeiter getarnte Geistliche wurden nach Berlin geschickt,
um ihren Landsleuten,
ca. 80 000 Zivilisten und Kriegsgefangenen, die für die
deutsche Kriegsindustrie
arbeiteten, religiösen und sozialen Beistand zu leisten.
Viele der Seelsorger wurden
1944 verhaftet; einige von ihnen kamen in Konzentrationslagern
ums Leben |
|
|
| |
nächste
Seite
|
| |